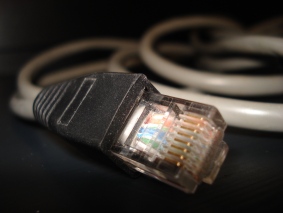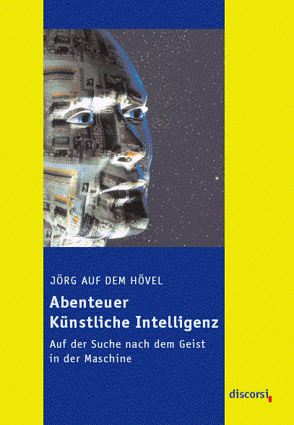/ Sitemap www.joergo.de bzw. www.aufdemhoevel.de Jörg Auf dem Hövel – Artikel zu Technik und Kultur – Eingangsseite Die Protestbewegung der 60er Jahre (I) Die Protestbewegung der 60er Jahre (II) ARGYREIA NERVOSA Ayahuasca Analoge Betel – Kaulust Sexy Betel – Über den Betel-Boom auf Taiwan Dieter Bohlen seine Wahrheit DU 782 – Lexikon der verschwindenen Dinge: Die Contenance DU 782 – Lexikon der verschwindenen Dinge: Die Telefonzelle.pdf Damania Ephedra Das kleine Graslexikon Das kleine Haschischsorten – Lexikon Interview_Kathrin_Spielvogel-GRAZIA.pdf Internet für Alle: Keep It Simple and Stupid KETAMIN Mimi und der Kifferwahn – Anti Marihuana Krimis der 50er Jahre Lactucarium TEUFELSDROGEN DIE PFEIFENKRITIK Wie der Staat mit Cannabis umgehen kann Die Mär vom Hirndoping – Rheinischer Merkur (pdf) Schlafmohn – Papaver somniferum Yohimbe Absinth- Der Fusel kehrt zuürck Abstinenz von der christlichen Idee zur Richtlinie der Politik Ätherisches Hanföl Im krisengeschüttelten Afghanistan wird wieder Haschisch produziert Das Ende der Akzeptierenden Drogenarbeit? Der LSD-Entdecker Albert Hofmann verstarb im Alter von 102 Jahren Alkohol Amazon wächst mit skalierbarer IT Des Apfelmanns knorrige Hände packen den Boskop Drogenpolitik in Arizona Ashwagandha Urlaub und Cannabispolitik in Australien Der Autor Ayahuasca kommt vom brasilianischen in den Großstadtdschungel. Mit Alex Jolig und Sam auf den Azoren Bananenschalen rauchen? High werden? Junggesellen und Haschisch- Graf von Baudissin plaudert drauf los Bayerischer Haschisch – eine wahre Geschichte Ein Haschischrausch im Sommerloch Eine satyrische Bilanz zur hundertsten Ausgabe des Magazin Hanfblatt blond – hunter s. thompson (pdf) blond 7/2002 – kelly trump (pdf) blond 100 (pdf) Aspekte der Sicherheit von E-Mail – Business Online 10/1997 An den kryptographischen Schlüsseln scheiden sich die Geister – Business Online 6/1998 Angst vor Piraterie, aber der Umsatz steigt, Business Online 7/1998 Horst Bossong: Wir nutzen nicht das, was in den Drogen steckt Interview mit dem A. Bredenfeld vom AiS, RoboCup Der Kongreß tanzt im Geist von Wolfgang Neuss Sohn von britischen Innenminister handelte mit Cannabis Rodney Brooks und die Maschinenmenschen Bungee Sprung vom Hamburger Fernsehturm Butandiol – GHB Die Cannabinoide und ihre Empfänger im Körper werden zu einem wichtigen Geschäft der Pharma-Industrie Cannabinoid Forschung Ein Vergleich der giftigen Inhaltsstoffe von Tabak und Marihuana Vom Mut kranker Menschen – Cannabis als Medizin Cannabis und die Lunge Das Ying und Yang der Cannabis-Psychose Die Macht der Pharma-Portale erbost das Kartellamt – Spiegel Online v. 15.10.2008 Viel THC, aber auch Pilze im Coffee-Shop Cannabis Computerspiele und Suchtgefahr Die IT-Architektur von Sabre (pdf) Costa Rica: „I make you good price, man“ Durch den Regenwald von Costa Rica Scientology im Cyberspace, ct 3/1996 Key Escrow, Computer Zeitung Ich, nur besser. Über Gehirndoping, Der Freitag v. 8. Juli 2010 Das Dilemma mit den neuen „Designerdrogen“ Chinas Gegner – Robert Enke und der Hundefellhandel Hünengräber, Langbetten, Dolmen: Auf Urkult-Tour in Norddeutschland Nun werden die Doping-Fabrikanten kreativ : Militante Mittel für Medaillenspiegel Drogen und Drogenpolitik – Texte von Jörg Auf dem Hövel und AZ Drogenklassifikationsversuche Was Drogentests leisten E-Mail-Sicherheit, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt v. 06.02.1998 Die Sprache setzt sich als Schnittstelle zwischen Mensch und Computer durch, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt v. 20.03.1998 Wohin mit den E-Mails von Schriftstellern?, DU, Nr. 752, Heft 11/2004 Die IT-Architektur von Ebay, Computerwoche, 18/2005 Die europäische Drogen-Beobachtungsstelle legt ihren Bericht für 2007 vor Durchatmen für Europas Kiffer Auge zu, Bussgeld oder Gefängnis Feiner Rohstoff – Der Journalist und Autor Jörg Fauser Das Pinguin-Imperium hat längst den Mittelstand erreicht, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Februar 2006 RFID in der Warenwelt, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 19.10.2004 Spam: Die digitale Plage, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. Juli 2003 Nur ein wenig Verschlüsseln ist schwierig, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.02.1998 Wem gebe ich meinen Schlüssel?, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 10.12.1996 Kiffen und Kiffer im Film Der Fliegenpilz – Ein Ausstellungsbesuch mit Wolfgang Bauer Amand Freiherr von Schweiger-Lerchenfeld FRESSFLASH Deep Fritz vs. Vladimir Kramnik, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 08.10.2002 Rezension: Robert Levine, Financial Times Deutschland(pdf) Kotzende Kiffer, durchgeknallte Diebe, pöbelnde Polizisten: 20 Jahre als Head-Shop-Besitzer Gastronomie-Tipp: Bergwolf Gastronomie-Tipp: Favorit Bar Gastronomie-Tipp: Monofaktur Gastronomie-Tipp: Negroni Bar Texte zur Gesellschaft Ginkgo biloba als Gedächtnisturbo? Welt am Sonntag v. 05.09.2009 GINSENG – EIN STECKBRIEF Die IT-Architektur von Google, Computerwoche, 20/2005 Container unter GPS-Kontrolle, FAZ vom 16.09.2003 Inselhopping auf den Kykladen Grohe – Die Mysterien des Haschisch Growing Area Der Aletsch Gletscher schmilzt, Hamburger Abendblatt (pdf) Die Erforschung psychedelischer Fische ist noch nicht über die Verbreitung von Mythen hinaus gekommen Hamburger Dialog 2003 Ja, Mann, heute ist Hanffest Kinderbuch Projekt: Zwei Kühe wollen heilige werden Oxytocin Historische Texte Hier nun eher Humor Angst und Schrecken mit Hunter S. Startseite – Artikel zu Technik und Kultur Warnung, Tarnung, Mimikry – Indoor-Anlagen Das Inferno Rennen in Mürren Interview mit Günther Amendt über Doping und die Pharmakologisierung des Alltags Interview mit Baba Rampuri Interview with Baba Rampuri Interview mit Gundula Barsch Interview mit Amon Barth Interview mit Jerry Beisler über den Haschisch-Trail und darüber hinaus Interview mit Ronald „Blacky“ Miehling Interview mit Mathias Bröckers Interview mit Jonathan Ott Interview with Jonathan Ott (EN) Interview mit Frank Zander von der Cannabusiness Interview mit dem Buchautoren Hans-Christian Dany über die Rolle von Amphetamin in der modernen Gesellschaft Interview mit Rick Doblin von MAPS Interview mit dem Kognitionsforscher John-Dylan Haynes Interview mit Mathias Erbe Interview mit dem Pharmazeuten Manfred Fankhauser Interview mit Ken Goffman aka R.U. Sirius über sein Buch Countercultures trough the Ages Interview mit Stefan Keuchel über Google, Blogs und Gut sowie Böse Interview Lester Grinspoon Interview mit Charles Grob Interview with Charles Grob Interview mit Franjo Grotenhermen Interview mit Franjo Grotenhermen Interview mit Jon Hanna über die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet der unerforschten Substanzen Interview mit dem Suchtforscher Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie der Berliner Charité Interview mit Tilmann Holzer über die Geschichte des Cannabis-Verbots und dem Ausweg aus der Sackgasse der Drogenpolitik Interview mit dem Hanf-Forscher Michael Karus Interview mit James S. Ketchum über chemische Kriegsführung Interview mit Martin Krause Cannabis im Straßenverkehr Interview mit dem Suchttherapeuten Helmut Kuntz Interview mit Bruno Martin Interview mit Nana Nauwald Interview mit dem Philosophen Oliver Müller über chemo- und neurotechnologische Umbaumaßnahmen an Körper und Geist Interview mit Joseph R. Pietri dem König von Nepal Interview mit Christian Rätsch Interview mit Michael A. Rinella über Plato, das Symposion und die philosophischen Ursprünge moderner Drogenpolitik Interview with Michael A. Rinella about Plato and the Pharmakon Interview mit Carsten Schäfer, Autor der Max-Planck Studie über Cannabiskonsum und Strafverfolgung in der Bundesrepublik Interview mit Stephan Schleim über das Gedankenlesen Interview mit dem Psychiater Eckart Schmidt Interview mit Daniel Siebert, dem weltweit führenden Experten für Salvia divinorum Interview mit Daniel Siebert, dem weltweit führenden Experten für Salvia divinorum Interview mit Renate Soellner Autorin der Studie „Abhängig von Haschisch?“ Interview mit Wolgang Sterneck Interview mit dem Bremer Suchtforscher Heino Stöver Interview mit dem Coffee-Shop-Veteran Nol van Schaik Interview mit Henning Voscherau über synthetische Opiate vom Staat und die erreichbaren Ziele der Drogenpolitik Interview mit dem visionären Künstler Fred Weidmann Interview mit Psychologen Wulf Mirko Weinreich über das Bewusstseinsmodell von Ken Wilber und die Zukunft der Drogenkultur Interview mit Hans-Georg Behr Interview mit Hans-Georg Behr II Interview mit Claudia Müller-Ebeling Interview mit Hans Cousto von Eve & Rave Interview mit Roger Liggenstorfer Interview mit Gerhard Seyfried Interview mit Wolf-Dieter Storl Interview mit Sven Meyer Interview mit Professor Sebastian Scheerer Interview mit dem Kriminologen Sebastian Scheerer II Interface 5 Selbstkontrolle statt Zensur Big-Brother Award, Internet World 1/2000 Belauschen die USA die Top-Secret-Kommunikation vieler Regierungen?, Internet World 1/99 Gehört der Schlüssel zum Schlüsseldienst?, Internet World 3/98 Das weltweite Lauschsystem Echelon hört das Internet ab, Internet World Vom Mythos zur Realität: Der Große Bruder hört mit Enfopol, Internet World 8/99 Kanada leidet trotz zahlreicher Proteste weiterhin unter der Cannabis-Prohibition Kawa Kawa Beste Trompete in der deutschen Blaskapelle Die Kiffer Typen Typologisierung – Der Schläfer Die Kiffer Typen Typologisierung – Der Dauerkiffer Die Kiffer Typen Typologisierung Die Kiffer Typen Typologisierung – Der Sexmuffel Die Kiffer Typen Typologisierung Die Kiffer Typen Typologisierung – Der Esoteriker Die Kiffer Typen Typologisierung Die Kiffer Typen Typologisierung – Der Künstler Die Kiffer Typen Typologisierung Wie man aus dem Kino herausgeführt wird Deutschlands Küsten werden sich auf den Klimawandel einstellen muessen Klippel – Haschisch und Haschaschin aus den „Aegyptische Skizzen“ Koerperwelten Koffein – Ein Streckbrief Die schwarze Welle – Der Kaffee- und Kaffeehaus-Boom Kokain – Eine Kontroverse Mal ganz unten, mal ganz oben, aber immer: Kokain Das Haschischschmuggel-Museum in Alexandrien – E. Koller (1899) Krähenaugen LAN-Wahn Die Hand an der Knüppelschaltung Cannabis und Straßenverkehr Grenzüberschreitend übers Ziel hinaus, Timothy Leary Legal – aber wie? Das Wunder von Lengede, Berliner Zeitung v. 8. November 2003 OHNE LICHT LÄUFT GARNIX LSD Männer und Rausch Malana Power Project Fincahotels im Hinterland: Das andere Mallorca Golfplatz-Einweihung mit Manni Kaltz Zusammen gekniffene Ärsche Modafinil, die Firma Cephalon und ein Selbstversuch Welche Musik macht den besten Sex? Marihuana Mythen, Marihuana Fakten: Übersicht Marihuana Mythen Teil 1 Marihuana Mythen 10: „Immer mehr Menschen werden wegen Marihuana-Konsum ins Krankenhaus eingeliefert“ Mythos 11: „Marihuana verursacht das Amotivationssyndrom“ Mythos 12: „Marihuana ist eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr“ Mythos 13: „Marihuana ist eine Einstiegsdroge“ Mythos 14: „Die Cannabispolitik der Niederlande ist gescheitert“ Marihuana Mythen 15: „Mythen kommen und gehen: Die Zusammenfassung“ Marihuana Mythen – Teil 2: Die Potenz von Marihuana ist über die Jahrzehnte wesentlich angestiegen Marihuana Mythen Teil 3 Marihuana Mythen Teil 4 Marihuana Mythen – Teil 5 – Cannabis schwächt das Immunsystem Mythos 6: Marihuana beeinflußt den sexuellen Reifeprozeß und die Fähigkeit zur Fortpflanzung Mythos 7: „Marihuana-Konsum während der Schwangerschaft schadet dem Fötus“ Marihuana Mythos 8 – „Marihuana verursacht Hirnschäden“ Marihuana Mythen 9: „Marihuana macht süchtig“ Engelstrompeten und andere Nachtschattengewächse Experimental Tourism in New York Öffentlicher Raum und Shopping-Malls, telepolis, 28.11.2003 Freie Software soll den Markt revolutionieren, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 21.03.00 Das Ying und Yang der Cannabis-Psychose Cannabis in Osteuropa Ottensen III Oxy – orientalischer Mohn Oxytocin Zwischen Mode und Tierschutz Etwas schief ins Leben gebaut, Hamburger Abendblatt vom 8. Dezember 1999 Wie mich jede Frau rumkriegt Ideen des Königlich Sächsischen Bezirksarztes Dr. F.R. Pfaff (1864) Interview mit Prof. Dr. Rolf Pfeifer Mit dem Sachverständigen Harry Käding in die Pilze Pilze Placebos: Warum der Schein besser wirkt als nichts, DIE WELT, 11.Juli 2008 Gastronomie Tip Restaurant Roma Gastronomie Tip Restaurant Cuore Mio Projekte Was für ein Dope-Freak bist Du Nützliche Varianten – Wie der Staat mit Cannabis umgehen sollte Reise und Natur: Länder, Menschen, Orte Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch – Der Buddhismus Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch – Die Christen Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch – Der Hinduismus Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch – Der Islam Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch Chemie-Apotheken müssen schließen Rezension AILO – Concepts Rezension Arno Adelaars, Christian Rätsch, Claudia Müller-Ebeling: „Ayahuasca. Rituale, Zaubertränke und visionäre Kunst aus Amazonien.“ Rezension Bommi Baumann: Rausch und Terror Rezension Detlev Briesen: Drogenkonsum, Drogenpolitik, Deutschland, USA Rezension Broeckers/Liggenstorfer: Albert Hofmann und die Entdecktung des LSD Rezension Harry G. Frankfurt – Bullshit Rezension Andreas Rosenfelder- Digitale Paradiese Rezension DJ Elbe – Sand Pauli Rezension T.C. Boyle – Drop City Rezension zu Fellner/Unterreiner: Morphium, Cannabis und Cocain Thomas L. Friedman will beschreiben, wie sich der Westen auf die Globalisierung einstellen muss Rezension Pinchbek – 2012: Die Rückkehr der gefiederten Schlange Rezension zu Michael Geißler: Acid, Mao und I Ging. Erinnerungen eines Berliner Haschrebellen Rezension Detlev Briesen: Drogenkonsum, Drogenpolitik, Deutschland, USA Rezension Max Goldt: Quite Quality Rezension Grice Scott – Die schönen Blödmacher Rezension Franjo Grotenhermen, Britta Reckendrees: Die Behandlung mit Cannabis und THC Rezension Holbein: Weltverschönerung Rezension Peyote und die Huichol-Indianer Rezension Bommi Baumann: Rausch und Terror Rezension Korf: Cannabis in Europe Rezension Robert Levine Die grosse Verfuehrung Die CIA und der globale Drogenhandel Rezension Jeremy Narby – Intelligenz in der Natur Rezension Ingo Niermann Adriano Sack: Breites Wissen Rezension Pinchbek – 2012: Die Rückkehr der gefiederten Schlange Rezension Wolfgang Schneider: Die „sanfte“ Kontrolle, Suchtprävention als Drogenpolitik Rezension Jens Förster: Kleine Einführung in das Schubladendenken Rezension Max Goldt: Quite Quality Rezension zu Timmerberg: Shiva Moon Rezension Wolf-Dieter Storl: Ich bin ein Teil des Waldes Rezension Wolfgang Schneider: Die „sanfte“ Kontrolle, Suchtprävention als Drogenpolitik Rezension Bernhard van Treeck: Drogen- und Sucht-Lexikon Rezension Wink & Wyk: Mind-Altering and Poisonous Plants of the World Rezension Jürgen Wolsch – Drogen. Ein Wissenscomic Rezension Zig Zag Zen – Buddhism and Psychedelics Rezensionen Drogen und Drogenpolitik Smarte Chips für die Warenwelt, Morgenwelt, 14.06.2004 Gekonnte Einzelaktionen Beobachtung über die Wirkungen des Haschisch des Bremer Afrikaforschers Gerhard Rohlfs 1866 Cannabis Routen Die IT-Struktur von Sabre, Computer Zeitung, 09.10.2006 Rundgang in Ottensen SALVIA DIVINORUM Die Allerschönste, PETRA, März 2006 Dope auf dem Schulhof Marihuana in den Groschenheften der Sechziger Jahre Die Schwitzhuette Seychellen – Reif für 115 Inseln Wichtige Regeln für das hanfgerechte Surfen und Posten im Internet Der Computer im Portemonnaie, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt v. 28.08.98 Auf dem Suwannee River Special Tabak Der Pulsschlag des Prozessors, Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 21.03.2000 Test eines Vaporizers „Happy, Happy, Same, Same“ Nach dem unblutige Putsch in Thailand ist wieder einmal König Bhumibol gefragt. Wer ist dieser Mann? Gefahr im Paradies – Das Reiseziel Thailand im Wandel Reportage, THC-Pharm, Dronabinol, Delta-9-THC Thesen_zur_Drogenpolitik Tiefe – oberflächlich betrachtet Tipi Aufbau Anleitung Ganz Ohr sein – Die Tomatis Hörkur, Hamburger Abendblatt vom 7. Januar 1998 Der spielerische Krieg, Telepolis, 3.9.2005 Tröpfchenweises Wissen Reine Ruhe statt Radau und Rabatz, Telepolis, 18.10.2005 Der mobile Kunde im Visier, Telepolis, 08.12.2005 Der Trend zum functional food zeigt die Virtualisierung der Ernährung und birgt mehr Risiken als Vorteile, telepolis, 02.01.2007 Freiflug für Buchschnipsel, Telepolis, 30.06.2006 Werbeslogans und Verpackungsangaben werden sich radikal ändern, Wucht und Wahrheit in Tüten Kupfer am Limit – Technik, Wünsche und Probleme bei IPTV Ich© liebe Dich® , telepolis v. 1.11.2004 Das Pokerfieber grassiert – Warum Pokern zum Volkssport aufsteigt Einleitung zum Telepolis Übermensch Blog – Projekt Übermensch: Upgrade ins Nirvana Web 2.0 FURZTROCKEN ABER GUT Trocknen von Cannabis In den USA hat sich Cannabis als Medizin längst durchgesetzt Cannabis-Politik in den USA Die sozialistischen Staaten und das Internet, Spiegel Online v. 28.05.2002 Ho Chi Minh im Freudentaumel Vietnam sucht den Zugang zum Internet, FAZ Herba Cannabis – Aus dem „Lehrbuch der Pharmacologie“ (1856) von Carl Damian Ritter von Schroff Vor zehn Jahren kam das Potenzmittel Viagra auf den Markt, Welt am Sonntag v. 25. März 2008 Helmut Wenske Wie München ist Lob der Übertragung. Die Kunstwerke der Ulrike Willenbrink Der Riambakultus – Aus einem Vortrag von Franz von Winckel (1890) Glasfasernetz bricht alle Rekorde, Computerwoche, 01.09.2006 Das spezielle Yoga des Inders Bellur Iyengar stärkt das körperliche und geistige Befinden Das macht sie alle willig – Zu Besuch bei „Zaubertrank“ in Hamburg Winderhude Special Tabak
Buch: Abenteuer Künstliche Intelligenz / (9 pages) Chessbase Rezension Joerg Auf dem Hoevel Abenteuer Kuenstliche Intelligenz De:Bug Rezension Joerg Auf dem Hoevel Abenteuer Kuenstliche Intelligenz FAZ Rezension Joerg Auf dem Hoevel Abenteuer Kuenstliche Intelligenz Abenteuer Künstliche Intelligenz. Auf der Suche nach dem Geist in der Maschine IX Rezension Joerg Auf dem Hoevel Abenteuer Kuenstliche Intelligenz Leseprobe I Leseprobe II Mac Profiler Rezension von Joerg Auf dem Hoevel: Abenteuer Kuenstliche Intelligenz RTV Rezension Joerg Auf dem Hoevel Abenteuer Kuenstliche Intelligenz
Buch: Pillen für den besseren Menschen (10 pages) Leseprobe Kapitel 7 (pdf) Anregungen und Korrekturen Bestellen Eingangsseite Inhaltsverzeichnis (pdf) Inhaltsverzeichnis Kontakt Panorama Skript Panorama (pdf) Rezensionen
Floating/ (24 pages) Startseite: Der Floating- und Samadhi-Tank Anwendungen Fine: Flotation REST in Applied Psychophysiology Floating PSO Magazin (pdf) Liste mit Float-Centern in Deutschland, Europa und auf der Welt Geschichte Hutchison’s MEGABRAIN Hersteller und Institutionen Interview John C. Lilly Interview John C. Lilly II JOHN C. LILLY (A CHRONOLOGY) https://joergo.de/tank/kjellgren_buhrkall_norlander_2010.pdf Kleinanzeigen Kontakt Lilly Biographie Lilly Monographie Literatur Programming and Metaprogramming Ernesto A. Randolfi Stress Management and Relaxation Center for the Worksite REST-Assisted Relaxation and Chronic Pain Peter Suedfeld, REST Research References The deep self – Auszüge Was ist ein Tank? Was ist Floating?