Growing Area
Und es wart Licht
Und anschliessend Trocknen
Aufbau einer kleinen Grow-Location: Insider-Tipps für Aktivisten

Und es wart Licht
Und anschliessend Trocknen
Aufbau einer kleinen Grow-Location: Insider-Tipps für Aktivisten

So recht will es keiner zugeben, aber der Genuss illegaler Drogen ist in Deutschland weit verbreitet. Haschisch und Marihuana werden von den meisten Menschen unter 30 schon gar nicht mehr zu den Drogen gezählt, mehr noch, in einigen Großstädten ist Marokk so normal wie Becks-Bier. Das Lebensgefühl der 90er, mit der symbolträchtigen Love Parade, ist ohne das Berücksichtigen von Ecstasy nur unzureichend beschreibbar, und wer nur ein wenig Erfahrung hat, der sieht aus den gegerbten Party-Fressen, die uns aus Society-Magazinen entgegen lachen, das starre Lachen des Kokain sprechen. Trotz der Mühen der Prohibitions-Armee aus Therapeuten und Politikern ist Deutschland im Dauerrausch.
Das große Tabu heißt: Drogen machen Spaß. Da sind die Spaßbremsen nicht weit, und Betriebe, Polizei und besorgte Eltern suchen nach Möglichkeiten der Substanzrecherche. So erleben Drogentests eine Konjunktur. Wo diese Tests früher aufwendig und kostspielig waren, drängen nun immer mehr Hersteller auf den Markt, die mit erschwingbaren Produkten auf den Endverbraucher zielen. In wie weit sind diese Tests in der Lage Cannabis- oder Ecstasy nachzuweisen? Wir haben den heroischen Praxis-Test durchgeführt und zwei Produkte genauer angeschaut.
Die Firma Diagnostik-Nord hatten wir auch getestet, man bat uns aber, den Test nicht zu veröffentlichten.
Um es den Fabrikaten nicht zu einfach zu machen und eine alltagsnahe Umgebung zu schaffen hatte unser sehr freiwillige Proband genau 72 Stunden (drei Tage) vor dem Test einen Tabakjoint mit rund einem halben Gramm Haschisch geraucht. Der Mann war kein Abstinenzler, aber auch kein Dauerkiffer, damit wollten wir ausschließen, dass sich aufgrund seines Fulltime-Hobbys ohnehin dauerhaft Cannabis-Abbauprodukte im Urin rumtreiben. Er hatte mindestens eine Woche vor dem Versuch kein Cannabis konsumiert. Um die deutschen Behörden nicht zu erregen, führten wir den Test in den Schweizer Alpen durch.
Bei einmaliger Kifferei ist diese von professionellen Labors 2-4 Tage im Urin nachweisbar, bei täglichem Konsum bis zu drei Monate lang. Danach fällt der Wert unter 50 Nanogramm pro Milliliter und ist von den meisten Tests nicht mehr aufzuspüren. Auch die vorliegenden Tests geben 50ng/ml als sogenannten cut-off an. Um diesen niedrigen Wert das zu Verbildlichen: Das enstpricht einem Stück Würfelzucker, aufgelöst in 60000 Litern Flüssigkeit (rund 1,5 Benzin-Tankwagen).
Der Drogendetektiv musste sich zuerst beweisen. Die Packung wirbt mit dem Satz Schlüssel zum Dialog. Auf telefonische Nachfrage bestätigte Jörg Engler von der Firma Drogendetektive, dass das Produkt primär als unterstützende Maßnahme in der problematischen Kommunikation zwischen Eltern und Kind dienen soll. Ich plädiere eher für eine Erziehung zum vernünftigen Drogengenuss als dazu, den Hammer zu schwingen, sagte Engler. Aha. Der Detektiv ist ein Schwestersystem der DrugWipe der Firma Securetec, die seit einigen Jahren erfolgreich von der Polizei eingesetzt wird und immer mehr Verbreitung in Streifenwagen findet. Der kleine Schnüffler ist tatsächlich so narrensicher zu bedienen wie beschrieben: Zunächst trennt man den stiftartigen Tester in zwei Teile, dann wischt man einen verdächtigen Gegenstand mit dem integrierten Wischvlies ab. Das schafft auch Mutti. Wir nahmen das Handy unseres Propanden, welches dieser regelmäßig nach dem kurzen Jointfestival genutzt hatte, um seiner Freundin in Deutschland mitzutielen, dass er noch lebt. Dann drückten wir das Flies zurück ins Gehäuse, etwas Wasser dazu und nach 10 Minuten waren die Kontrolllinien rot, wir hatten den Test also korrekt ausgeführt, nur stand bei CA (für Cannabis) kein Ergebnis auf der Skala.

In einem zweiten Anlauf wurden wir direkter: Wir wischten erneut das Handy, dazu noch die Computer-Tastatur und den Haustürschlüssel des Probanden ab. Und siehe da: Der Drogendetektiv schlug an und zeigte eine rote Linie bei CA. Weil wir gerade so eifrig bei der Sache waren, hantierten mit ein wenig Ecstasy (MDMA aus Zürich) und telefonierten danach wieder mit dem bereits mit THC kontamierten Handy. Der Drogendetektiv machte auch dieses mal Wuff und zeigte neben CA nun auch einen roten Streifen bei AM an. AM steht hier für Amphetamine und Methamphetamine und dessen Derivate wie MDMA. Um endlich klare Ergebisse zu erhalten führten wir einen dritten Testlauf durch. Wir wischten ein Feuerzeug, das unser Proband am Vorabend (17 Stunden später) für eine Haschisch-Bröselaktion genutzt hatte, gründlich ab. Aber der Schnüffler zeigte kein THC an, der Detektiv blieb stumm. Obwohl das Feuerzeug nicht mehr benutzt und auch nicht gesäubert wurde, war die Nachweisgrenze für den Test offenbar erreicht.

Als zweiter im Feld startete das Produkt der Firma Gecko-Pharma. Der Vorteil des Gecko ist, dass sowohl Gegenstände als auch Urin untersucht werden können. Der Packung sind Handschuhe und Fließmittel für das Abtupfen von Gegenständen beigelegt. Krankenhaus-Atmosphäre machte sich breit, nur befand sich leider die angekündigte Pipette nicht nicht in der Packung. Nach dem Tränken des Teststreifens mit Kifferurin zeigte keines der Anzeigenfenster eine Reaktion. Entweder ist der Test zu unsensibel oder die Cannabis-Abbauprodukte hatten sich bereits nach drei Tagen unter die Nachweisgrenze verkrümelt. In der Gebrauchsanweisung fand sich kein Hinweis darauf, innerhalb welches Zeitraums Test überhaupt positiv anschlagen kann ein unbedingtes Manko des Gecko. Ebenfalls fehlte ein Hinweis auf die Nachweisgrenzen, selbst auf der Website der Firma war hierzu nichts zu finden. Erst in einem pdf-Dokument auf der Internetseite des Schwesterprodukts der Firma Gabmed wurden wir fündig. Im Urin soll der cut-off Wert bei 50 ng/ml THC-Metaboliten (den Abbauprodukten des Rauschhanfs) liegen und zwischen 3-5 Tagen, nach Langzeitkonsum mehrer Wochen nachweisbar sein. Unser Elchtest konnte dieses optimistischen Angaben nicht bestätigen. Ein zweiter Durchlauf sollte dem Gecko eine bessere Chance geben. Diese Mal genoss unser Proband eine Purpfeife mit rund einem halben Gramm hochwertigen, afghanischen Haschisch. Der anschließende Kino-Besuch verlief für alle Beteiligten gut, nicht aber der Test am nächsten Abend, genau 24 Stunden nach dem Konsum. Das Urin des Probanden zeigte nach Aussage des Gecko-Test keine Spuren von THC. Nach den Statuten des Gecko war er also ein sauberer Kandidat.
Freundlicherweise hatte uns die Firma weitere Geckos zur Verfügung gestellt, so das wir noch einen Oberflächentest durchführen konnten. Die Nachweisgrenze ist auch hier in der beiliegenden Broschüre nicht erwähnt, sie liegt für THC laut pdf-Dokument bei 15000 ng/ml. Dies ist wahrscheinlich zu unsensibel, um THC auf Gegenständen von Kiffern nachzuweisen, deren Konsum mehr als fünf Tage zurück liegt, in unserem Fall reichte es aus. Wir wischten das Feuerzeug, mit dem am Vorabend die Flamme des Bröselns entfacht worden war, mit dem beigefügten Tupfer ab. Nun noch etwas Gefriemel mit der Fließmittelflasche und siehe da: Der Gecko-Drogennachweis schlug an und zeigte THC an.
Die Chemo-Schnüffler hinterlassen einen zwiespältigen Eindruck. Geht man davon aus, dass die von den Herstellern angegebenen Spezifikation korrekt sind, dann sind die THC-Metaboliten unseres Probanden anscheinend innerhalb von drei Tagen unter die Nachweisgrenze zersetzt worden. Wer also am Freitag kifft und kein Dauerkiffer ist, der wird weder von Vati noch vom Chef am Montag überführt werden können. Das von uns gewählte Testschema war für die Urintests zu diffizil. Im direkten Kontakt mit der Substanz schneiden die Detektive auch nicht glorreich ab. Aber wer will sich auf deren Versagen verlassen? Besser ist es natürlich gar nicht erst zu Kiffen, aber sollen wir nun wirklich alle meditieren lernen, um zu entspannen?
Nachweis von Rauschhanf im Körper
Die Nachweisbarkeit von Cannabis im menschlichen Körper hängt nicht nur von der Höhe und Dauer des Konsums ab, sondern auch von Körperfett und Stoffwechsel der Person ab. So speichert beispielsweise ein dicker Mensch mehr Cannabis-Abbauprodukte (Metaboliten) in seinem Körper als ein dünner Mensch. Im Blut kann die THC-Carbonsäure im Extremfall bis zu 25 Tage nachgewiesen werden, im Urin werden die Metaboliten bei einmaligen Konsum bis vier Tage, bei chronischem Konsum mehrere Wochen bis hin zu Monaten gefunden. Der Urintest kann einen zurückliegenden nicht von einem kurzfristigen Konsum unterscheiden. Wenn THC jedoch im Blut gefunden wird, kann von einem kurz vorher (5-12 Std.) erfolgten Joint-Genuss gesprochen werden. In den Haaren lässt sich Hanf bis zu sechs Monate lang verfolgen.
Ein THC-Rechner unter http://www.erowid.org/plants/cannabis/ zeigt grafisch an, wie lange es braucht, damit Hanfkonsum im Urin nicht mehr nachweisbar ist. Das Programm ist unzuverlässig, weil jeder Körper anders reagiert, einen Richtwert kann man damit aber erhalten.

Es begab sich einst im Jahre 1925, daß die Versuchsstation für technischen und offizinellen Pflanzenbau GmbH Happing bei Rosenheim in Oberbayern (wo sonst?) in der Fachzeitschrift „Heil- und Gewürzpflanzen“ (VIII. Bd., S. 73-82) vollmundig verkündete: Cannabis indica kann „in Deutschland überall, wo guter Weizen gedeiht, mit Erfolg gebaut werden. Unser Anbau ist längst aus dem Versuchstadium herausgekommen und zum Anbau im Großen geworden. In den letzten Jahren lieferten wir dem deutschen Großdrogenhandel 3000 Kilo und sagen deshalb…für Cannabis indica: Das englische Welthandelsmonopol wird in Kurzem der Geschichte angehören. Voraussetzung ist der Anbau einer hochwertigen, akklimatisierten Saat. Daß von uns nach den acht Jahren Auslese und Dutzenden von Analysen die Hochhaltung im Auge behalten wird, ist selbstverständlich. Im Herbste werden wir an Interessenten Samen abgeben können.“
Diese glückverheissenden Zukunftsperspektiven konnten natürlich in der etablierten Fachwelt nicht unwidersprochen bleiben. Schon damals waren die medizinischen Wirkungen des Indischen Hanfes und seiner psychoaktiven Zubereitungen, die man ganz allgemein unter dem schwammig verwendeten Begriff Haschisch zusammenfasste, umstritten. Die praktische Anwendung beschränkte sich auf einige wenige Präparate. Die Firma „Fresenius“ in Frankfurt am Main stellte beispielsweise eine Kombination des Barbiturat-Schlafmittels „Veronal“ mit dem Extrakt des Indischen Hanfes her, das „Indonal“. Diese die notwendige Dosis und die unerwünschten Nebenwirkungen des Veronals angeblich senkende Kombination fand ihren Fürsprecher in einem Wissenschaftler namens Emil Bürgi (Dtsch. Med. Wschr. 7.11.1924), vielleicht einem Ahnen des bekannten Lochfraß-Experten der Gegenwart. Vor allem landete aber der Großteil des produzierten Hanfextraktes in Deutschland als Zusatz in Einpinselungen und Pflastern auf Salicylkollodium-Basis zur Entfernung von Hühneraugen, einem Leiden über das heutzutage nur noch hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird und das auch nicht durch engagierte Hühneraugenstiftungen oder Benefiz-Veranstaltungen vom Typ Life-Hühneraugen-Ball von sich Reden macht. Dr. Th Sabalitschka aus Berlin, der die Happinger Anbauversuche kontrollierte und die Ergebnisse publizierte, bemühte sich aber an weitere zurückliegende therapeutische Anwendungen zu erinnern. Die bereits erfolgreiche Verwendung von Cannabis bei Starrkrampf, bei Lyssa, Cholera, chronischen Rheumatismen, Delirium tremens, Husten, Strychninvergiftung und als wehenförderndes Mittel sei wissenschaftlich zu überprüfen. Es bestünde „in der Therapie für Cannabis eine vielseitige Anwendungsmöglichkeit, die aber erst richtig ausgenutzt werden kann, wenn Drogen und Präparate von bekannter und sicherer Wirksamkeit zur Verfügung stehen.“ Die Bewertung des medizinisch einzusetzenden Hanfkrautes war damals allerdings schwierig, da man die wirksamen Inhaltsstoffe noch nicht kannte. Man wußte lediglich, daß es sich bei den psychoaktiven Wirkstoffen um harzige Bestandteile handeln mußte.
Dieser Einschätzung der medizinischen Möglichkeiten widersprach Dr. Ernst Joel vom Gesundheitsamt des Bezirks Berlin-Tiergarten aufs Heftigste (Klin. Wschr. 26.2.1926). Alle genannten Indikationen seien praktisch obsolet. Er formulierte eine klassische Position der Rauschhanf-Prohibitionisten: „Wir sehen im indischen Hanf kein aussichtsreiches Heilmittel, sondern ein Rauschgift ersten Ranges, ein Genußmittel, dem im Orient Millionen von Menschen süchtig verfallen sind, ein Mittel, das nicht anders als das Opium und das Cocain seelische Alterationen bis zu psychotischen Krankheitsbildern hervorruft. Bis jetzt kennen wir in Deutschland noch keinen Haschischgenuß. Und zwar deshalb nicht, weil, wie die Geschichte der Rauschgifte lehrt, der genußsüchtige Mißbrauch an den therapeutischen Gebrauch anzuknüpfen pflegt. Es gab bei uns erst dann einen Cocainismus, als das Medikament Cocain eingeführt worden war, und es gibt weiter Cocainismus, nachdem schon das Cocain die Therapie fast verlassen hat. Es gibt keinen Haschischismus, weil der Hanf therapeutisch keine Rolle spielt. Wir werden ihn haben, wenn man den indischen Hanf popularisiert, und wir werden ihn haben, auch wenn er sich dabei therapeutisch nicht besser bewähren wird als bisher.“ Daraufhin fordert er Maßnahmen, „durch die das wissenschaftliche Arbeiten mit einheimisch wachsendem indischen Hanf unangetastet bleibt, aber sein Verkehr und seine Verbreitung schärfstens überwacht und nach Gesichtspunkten des medizinalen Bedarfs geregelt werden.“ Das „englische Welthandelsmonopol“ könnte man „leicht dadurch gegenstandslos machen, daß man – ohne Schaden – bei den Hühneraugenmitteln Cannabis indica fortläßt.“
Die so ins Rollen gebrachte Diskussion über die Notwendigkeit eines Anbaus von Indischem Hanf in Deutschland fand ihre Fortsetzung in der Antwort von Sabalitschka (Klin. Wschr. 9.7.1926), in der er einen totalen Rückzieher machte und die Versuche nur noch aus einer Bedarfssituation heraus verteidigte: Es „bestand und besteht heute noch in Deutschland ein Bedarf nach Herba Cannabis Indicae und dem daraus bereiteten Extrakt, wenn dieser Bedarf auch nicht erheblich ist. Der Bedarf Deutschlands konnte in der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht mehr durch Import gedeckt werden.““Es war somit wirtschaftlich angezeigt oder notwendig, die Erzeugung einer dem echten indischen Hanf nahekommenden Droge in Deutschland zu versuchen.“ „Selbstverständlich soll der Anbau sich nur in den Grenzen dieses Bedarfes halten, soweit nicht auch Ausfuhr möglich ist. Der Anbau muß auch so durchgeführt werden, daß er nicht zu einer Verwendung der Droge als Genußmittel in Deutschland führt.“ „Eine Popularisierung ist wegen der damit verbundenen Gefahr des Haschischismus und einer Überproduktion zu vermeiden.“ Und zaghaft: „Durch sachgemäße Kultur unter Kontrolle durch Pharmakologen und Chemiker erscheint es möglich, zu gleichmäßiger Droge und gleichmäßigen Präparaten zu kommen, wodurch die pharmakologischen und klinischen Versuche über die Wirkung dieser Pflanze und ihrer Inhaltsstoffe unterstützt würden. Von dem Ergebnis dieser Untersuchungen wird dann die Entscheidung abhängen, ob der indische Hanf weiterhin in der Therapie irgendwie verwendet werden oder ob er allgemein aus der Therapie und den Arzneibüchern verschwinden soll.“
Joel setzt in einer „Erwiderung“ noch einen drauf, indem er eine eigene Untersuchung vorlegt, die den Einsatz von Cannabis indica-Extrakt als lokalanästhetischen Zusatz bei der Behandlung von Hühneraugen, wie dies ein Mann namens Unna Ende des 19. Jahrhunderts empfohlen und eingeführt hatte, auf Grund einer mehrere Tage anhaltenden hautreizenden Wirkung sogar als kontraindiziert erscheinen läßt. „Man bemüht sich gegenwärtig vielfach, unnütze und verteuernde Ballastbestandteile aus der Therapie zu entfernen. Hier liegt ein geeigneter Fall vor. Wir brauchen weder Einfuhr noch Anbau von indischem Hanf und sollten froh sein, mit einem zwar wissenschaftlich interessanten, sonst aber ebenso überflüssigen wie gefährlichen Mittel nichts zu tun zu haben.“
Aber zurück zu den jahrelangen Anbauversuchen: Wie bereits erwähnt, begann man, als sich während und nach dem Ersten Weltkrieges Schwierigkeiten bei der Einfuhr von Herba Cannabis Indicae (Indischem Hanfkraut) ergaben, mit den besagten Versuchen, „in Deutschland indischen Hanf anzubauen und eine hochwertige Droge zu erzielen“. Der Versuchsstation in Happing war es „gelungen, die Samen der echten Cannabis indica „Gunjah“ nach Deutschland zu bringen, mit welchem die Versuche angestellt wurden. Bei der Selektion strebte die Versuchsstation nicht nur nach einer Pflanze von hohem Harzgehalt, sondern auch von einem typischen, von der gewöhnlichen Cannabis sativa möglichst verschiedenen Aussehen.“ Es war schließlich „tatsächlich eine typische Form erreicht worden; sie ist schwächer und graziöser als die gewöhnliche Form und entspricht dem Habitus des indischen Hanfes. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Form noch charakteristisch durch die tiefdunkle Färbung der Stengel und Stiele…
Die Züchtung dieser Form bot den Vorteil, schon aus dem äußeren Habitus Rückschlüsse auf den Harzgehalt der Pflanze ziehen zu können, während man sonst den Harzgehalt nur aus der größeren oder kleineren Klebkraft der Pflanzen beim Anfassen schätzen kann.“ Es gelang auch den Harzgehalt des geernteten Hanfkrautes erheblich zu erhöhen. Liessen sich aus dem „Ersten Nachbau aus indischen Originalsamen“ im Jahre 1917 noch nur 8,7 % Extrakt gewinnen, waren es 1918 bereits 12,4 %, 1919 17,3 %, 1920 19,8 % und 1921 20 %. In den folgenden drei Jahren pendelte sich der Wert bei knapp 19 % ein. Es wird allerdings eingeräumt, daß es sich hierbei um Werte einer besonders guten hochwertigen Droge handle. „Für die durchschnittlich geerntete Droge lagen die Werte um 1-2 % niedriger.“ Zur Extraktion verwendete man 90 %igen Alkohol. Das nach Verdampfung des Extraktionsmittels erhaltene Produkt würde man heute „Grasöl“ nennen. Interessant auch die Schlußfolgerung der Anbauversuche: „Daraus ergibt sich, daß auch in Deutschland die Gewinnung eines Hanfes mit hohem Harzgehalt möglich ist und daß der Harzgehalt weniger vom Klima abhängt, sondern vielmehr von der Hanfrasse. Der gewöhnliche Hanf erzeugt in Deutschland ebensowenig größere Harzmengen, wie in Indien.“ Damit erklärten sich auch die früheren gescheiterten Versuche aus dem gängigen Faserhanf ein psychoaktives Präparat zu gewinnen. Obendrein zeigte sich bei den Happinger Anbauversuchen noch, „daß der indische Hanf durchaus nicht so kälteempfindlich ist“. Dennoch sollte sich vor allem der Mythos, von der klimatischen Abhängigkeit der Hanfpotenz, von zahllosen Publikationen wiedergekäut, noch über Jahrzehnte halten, ganz im Sinne der Hanfprohibition, der eine unabhängige Selbstversorgung der Konsumenten durch einen einfachen und unproblematischen Anbau in Haus, Garten und weiter Flur natürlich ein Greuel ist, wie ja jüngst das absurde Hanfsamenverbot und die Hatz auf Homegrower deutlich belegen.
1920 kam das Deutsche Cannabis Indica-Kraut erstmals auf den Markt. Der Handel in Deutschland unterlag damals noch keinen Reglementierungen. Erst 1929 wurde der Indische Hanf durch Aufnahme in das internationalen Abmachungen von 1925 folgende Opiumgesetz verboten und verschwand aus dem freien Drogenhandel. Die Indische Ware wurde Mitte der Zwanziger Jahre teurer und schwerer erhältlich, und schließlich durch als weniger ergiebig geltendes Hanfkraut aus Zansibar (Ostafrika) verdrängt. (W. Wiechowski in Prag gewann mit Petroläther aus der Indischen Droge 20 %, aus der Afrikanischen 8 % und aus der Deutschen 5 % harzigen Extrakt, wobei hier nichts über den wahren Gehalt der damals noch unbekannten Wirkstoffe gesagt war. Arch. f. Exp. Path. u. Pharm. 119. Bd. 1927) So kostete beispielsweise bei dem Hamburger Drogen- und Chemikalienhändler „Krenzin & Seifert“ Indisches Hanfkraut 1924 noch pro Kilo 15 Mark. 100 Kilogramm waren für 1450 Mark zu haben. 1925 kostete es aber bereits 35 Mark pro Kilo. Die afrikanische Ware war dagegen für 12 Mark das Kilo erhältlich. Die Drogengroßhändler „Caesar und Loretz“ in Halle, die auch eigene Anbauversuche mit Cannabis indica unternahmen und sich der in Happing produzierten Ware annahmen, hielten diese „im allgemeinen noch für besser als die afrikanische, so daß man sich mit ihr als Ersatz für die nicht zu beschaffende, echte, indische voll begnügen könne.“
Um die psychoaktive Wirkung des oberbayrischen Hanfkrautes zu belegen, konnte man letztlich auf Menschenversuche nicht verzichten. Zunächst mußte ein starker Tabakraucher ran. Während die erste Pfeife mit 2 Kubikzentimeter Inhalt keine Wirkung zeigte, hatte er nach der zweiten Pfeife „ein merkwürdiges Gefühl von Frohsein, ohne es einer Berauschung vergleichen zu können. Es war ungefähr so, wie morgens 11 Uhr ein Glas guter Weißwein wirkt.“ „Eine dritte Pfeife erzeugte nach Ablauf von ungefähr einer Stunde Ermüdung und ich schlief häufig 4-5 Stunden länger als sonst.““Nachwehen des Hanfrauchens verspürte ich nie, obwohl ich schon in einer Woche viermal je drei bis vier Pfeifen rauchte. Der Rauch des Hanfes ist nicht angenehm und erzeugt im Anfang etwas Übelkeit.“
Mit soetwas und ein paar Versuchen an Kaninchen und Hunden konnten sich die Forscher nicht begnügen. So bildete das am Pharmakologischen Institut in München (Hermann Gayer, Arch. f. Exp. Path. u. Pharm., 129.Bd., 1928) mittels Petroläther zu 3 % aus dem „Herba Cannabis ind. Happings“ extrahierte Rohharz ab 1925 die Grundlage für Versuche am Menschen. Zum Vergleich wurde persisches Haschisch extrahiert, das einen Harzgehalt von 35 % aufwies. Das Happinger Harz erwies sich allerdings als gleichermaßen potent. Gayer stellte aus dem Extrakt Tabletten her und prüfte deren Wirkung zunächst „sowohl an mir selbst wie auch an mehreren Herren des Institutes, die sich freundlicherweise zu den Versuchen bereit erklärten. Dosen von 1 g Herba können als wirkungslos bezeichnet werden, auch bei 2 g Herba ist noch keine sichere Haschischwirkung zu bemerken, dagegen kann 3 g als bei allen sechs Versuchspersonen wirksam bezeichnet werden. Hier tritt nach etwa 1-2 Stunden jene oft beschriebene unüberwindliche lächerliche Heiterkeit ein, die anfallsweise sich wiederholt. Wehrlosigkeit gegen ideenflüchtige Assoziationen, aufmerksames Lesen ist nicht mehr möglich. In der 3. Stunde apathische Bewegungslosigkeit und Entschlußunfähigkeit, psychisch Halluzinationen und Illusionen, nach 5-6 Stunden übergroße Schläfrigkeit und Schlaf, aus dem man nach 2-4 Stunden in normalem Zustande aufwacht. Bei mehreren Versuchspersonen war auffallend ein in den ersten Stunden eintretender Heißhunger.“ „Dosen von 6 g Herba sind als sehr große zu bezeichnen, hier traten schon starke Rauscherscheinungen auf mit Exaltationen, so daß die Versuchspersonen unter dauernder Überwachung bleiben mußten.“
Von diesen Versuchen berichtete auch Professor Walther Straub („Bayerischer Haschisch“, M. Med. Wschr. 6.1.1928). Ihm zufolge bewirkten bereits 0,05 g des Extraktes oral eingenommen eine „charakteristische Ideenflucht“. „Eine sichere Haschischrauschwirkung“ wurde mit 0,1 Gramm, also entsprechend 3 Gramm des Krautes, erzielt. Es stellte sich ihm zufolge heraus, daß „die Gehirnwirkung, der Rausch nach Kulturherba“ „am Menschen der Qualität nach genau derselben Art“ ist „wie die „künstlichen Paradiese“ der Literatur über orientalischen Haschisch und am Mitteleuropäer wenigstens von derselben problematischen Güte.“ Die „Herren Dr. Kant und Dr. Krapf“, Assistenten der Psychiatrischen und Nervenklinik München wurden von Professor Straub schließlich gebeten, „eine methodische, psychopathologische Analyse der Haschischwirkung“, die „nur vom Fachmann geliefert werden“ könne, beizubringen. Die beiden unterzogen sich daraufhin heroischen Selbstversuchen (Arch, f. Exp. Path. u. Pharm. 129.Bd., 1928) mit dem „Bayerischen Haschisch“. „Der Selbstversuch mit Rauschgiften ist für den Psychiater deshalb von besonderer Bedeutung, weil er ihm am unmittelbarsten das Studium krankhafter seelischer Zustände ermöglicht.“ „Wir sind daher gern der Anregung von Prof. W. Straub gefolgt, die Wirkung von Haschisch am Menschen zu studieren, und haben aus den oben dargelegten Gründen die Form des Selbstversuches gewählt.“ Dabei wurden Dosen eingenommen, die 3 Gramm, 6 Gramm und 9 Gramm des Krautes entsprachen. Auch hier zeigte sich „daß der europäische Kulturhaschisch denselben Rausch erzeugen kann, den im Osten Millionen von Menschen als einzigen narkotischen Genuß des Daseins kennen, pflegen und schätzen.“ Der in Tablettenform eingenommene Extrakt hatte jedoch einen großen Nachteil: Da er nicht in Wasser löslich war, dauerte es Stunden, bis er seine volle Wirkung entfalten konnte und „das einigermaßen begehrenswerte Stadium des euphorischen Rausches eintrat, länger als ein beschäftigter Mitteleuropäer auf einen Genuß warten könnte.“ Mit einer massenhaften Verbreitung des Haschischkonsums in deutschen Landen infolge des Bayrischen Eigenanbaus rechnete Straub nicht. „In den Schilderungen der Europäer über ihren jeweiligen Haschischrausch ist eigentlich nichts enthalten, was so sehr begehrenswert erscheint, und wohl für alle Selbstversucher ist der Haschischrausch nur Episode geblieben.“
Eine interessante Anekdote handelt noch von einer Versuchsperson, die „ohne es zu wissen, eine leere Tablette bekam“ und sich wunderte, „daß die erwartete und bekannte Wirkung nicht auftrat.“ Sie wurde nun „aufgeklärt, daß nur ein Scheinversuch gemacht wurde“. Sie „billigte dies vom wissenschaftlichen Standpunkt völlig und bekam dann die Haschischtablette. Die nunmehrige Haschischwirkung stand nun völlig unter dem nachträglich aufgetretenen Aerger über die Täuschung mit der leeren Tablette, der Aerger steigerte sich bis zur Aggressivität, die Versuchsperson wurde direkt gefährlich!“ Aber war ja auch ne Gemeinheit!;)
Bemühungen , die „mit kleinen Dosen erzielbare Euphorie“ zu nutzen, um „vielleicht einen depressiven Melancholiker vergnügt“ zu „machen“ wurden „mit dem bayerischen Haschisch in Angriff genommen“, seien „aber noch nicht spruchreif.“
Kant verabreichte das „Bayerische Haschisch“ später auch noch einigen seiner Patientinnen, um deren Reaktionen zu beobachten (Arch. f. Psych. u. N, Bd.91, 1930). „Wir gaben in der Hälfte der Fälle die wirksamen Bestandteile von 6 g, in der anderen Hälfte von 9 g Herba cannabis indica. Unsere Versuchspersonen waren 9 manisch-depressive und 10 schizophrene Frauen, außerhalb einer Phase bzw. Schubes, jedenfalls frei von akuten psychotischen Erscheinungen.“ Man wollte mal sehen, welche Symptome sich durch die „exogene Noxe“ Haschisch auslösen lassen.
Und schliesslich geriet die ganze kuriose wissenschaftliche Episode in Folge des Opiumgesetzes von 1929 in Vergessenheit. Es war einmal in Bavaria…
Wissenschaftler der Universität Leiden in den Niederlanden haben Cannabiskraut aus zehn zufällig ausgewählten Coffee-Shops mit zwei Sorten verglichen, die in Apotheken auf Rezept zu erwerben sind.
Zusätzlich wurde eine Sorte einer nicht-offiziellen Initiative für medizinischen Cannabis untersucht. Bei allen elf „halblegalen“ Proben lag der THC-Gehalt in einer Spanne zwischen 11,7 und 19,1 % (Prozentgehalt des Trockengewichtes des Pflanzenmaterials). Der THC-Gehalt der Apotheken-Sorten fiel ebenfalls in diesen Bereich: die Sorte Bedrocan (16,5 % THC) fand sich im mittleren Bereich, während die Sorte Bedrobinol (12,2 % THC) am unteren Ende der Spanne lag.
Neben THC und THCA wurden während der Analyse der Cannabinoid-Zusammensetzung der Proben auch andere Cannabinoide berücksichtigt. Allerdings wurden keine größeren Unterschiede zwischen den Coffee-Shop-Proben beobachtet. Der Autor der Studie, Arno Hazekamp, vermutet, dass dies das Ergebnis von Jahrzehnten der Kreuzung und Selektion von viel THC produzierenden Cannabissorten ist. Hazekamp: „Dieser Prozess hat die Variabilität zwischen den Cannabissorten verringert, mit einer geringfügigen Ausnahme für ihren THC-Gehalt.“
Ein zweites wichtiges Ergebnis der Studie: Alle (sic!) Proben aus den Coffee-Shops enthielten Kontaminationskonzentrationen für Bakterien oder Schimmelpilze oberhalb der Grenzwerte, die im Europäischen Arzneibuches für Präparate zur Inhalation vorgegeben sind. Einige der gefundenen Mikroben können Gifte bilden, die beim Rauchen von Cannabis nicht vollständig zerstört werden. Vor allem Personen mit einem bereits beeinträchtigten Immunsystem, beispielsweise AIDS- oder Krebs-Patienten, können solche Mikroben und Gifte gefährlich werden. Das Vorkommen potenziell gefährlicher Pilze auf nicht legal gezüchteten Cannabis ist wiederholt beschrieben worden, einige diese Pilze gelten als Quelle für neurologische Toxizität oder Infektionen. Die zwei Apothekenprodukte wiesen eine konsistente Stärke auf, potenziell gesundheitsschädliche Verunreinigungen fehlten.

Ernst Klippel war ein großartiger Kenner der arabischen Welt, der diese jahrelang bereiste. Natürlich wußte er auch vom Haschisch zu berichten:
„Die türkische Regierung sowohl als die ägyptische haben nämlich in ihrer bekannten Sorge um das Wohl ihrer Untertanen den Anbau und den Verkauf des gesundheitsschädlichen Narkotikums strenge verboten.
Die selbstverständliche Folge des Verbotes war die Entwicklung eines grossartigen Schmuggelsystems. Die Pfiffe und Kniffe griechischer Händler, wenn es sich um einen Geldgewinn handelt, sind von jeher berühmt, und die ägyptischen Zöllner wissen ein Lied davon zu singen. Bald trifft eine Schiffsladung Brennholz in Alexandrien ein, und die findigen Beamten machen die betrübende Entdeckung, dass jedes Scheit ausgebohrt und mit dem verfehmten Genussmittel gefüllt ist, bald werfen harmlose Schiffer auf ihrer Fahrt durch den Suezkanal ganze Fässer voll der verbotenen Ware über Bord, die dann von unternehmenden Armeniern aufgefischt und geborgen werden. Doch sind seit der englischen Besatzung die Beamten wunderbar wachsam und abgefeimt; wohl an achtzig Prozent aller Schmuggeleien werden entdeckt. In jedem Falle wird das Haschisch beschlagnahmt und dazu noch eine hohe Geldstrafe auferlegt. Die konfiszierte Ware wird schliesslich gestempelt und dann – öffentlich meistbietend ins Ausland verkauft. Offenbar hat das vorher so gesundheitsschädliche Haschisch durch die Stempelung seine giftigen Eigenschaften verloren. Und auch der Fiskus profitiert alljährlich ein hübsches Sümmchen durch diese Konfiskationen, sowie durch die Razzias auf die Kaffeehäuser, wo dem verbotenen Genusse gehuldigt wird.
Was nun die gesundheitsschädliche Wirkung des narkotischen Krautes anlangt, so lässt sich allerdings nicht leugnen, dass ein übertriebener Genuss, namentlich bei unzureichender Ernährung, geradezu verheerend auf den Körper wirkt. Ich habe neulich die grosse Staatsirrenanstalt in Abbassieh bei Kairo besucht. Dort waren vier grosse Säle, angefüllt mit lauter Prinzen, Königen und Kalifen – wenigstens hielten sich die Leute selbst dafür -, alles frühere Handwerker, Arbeiter, Eseltreiber, welche sich durch übermässiges Haschischrauchen um ihren Verstand gebracht hatten. Indessen beweist mir jahrelange Beobachtung, dass ein mässiger und geregelter Genuss bei guter Ernährung nicht im geringsten schädlich wirkt. Die schlimmste Folge eines einmaligen Zuviel ist eine gewisse Trägheit und Abspannung am nächsten Tage. Viel kommt auch auf die Qualität des Narkotikums an. Das sogenannte yunany – griechische – ist viel schwerer und unzuträglicher als das feine aromatische schamy oder syrische. Früher war das balady oder einheimische ägyptische Haschisch berühmt, doch hat das Verbot des Anbaues, das seit mehr denn fünfundzwanzig Jahren im Nillande besteht, dem gewöhnlichen Sterblichen diesen Genuss unmöglich gemacht. Höchstens einige einheimische Granden und Feinschmecker dürfen es wagen, ein kleines Eckchen ihrer hermetisch abgeschlossenen Gärten mit diesem Zauberkraute zu bepflanzen.
Wie allgemein verbreitet der Haschischgenuss trotz aller Verbote heutzutage doch noch ist, lässt sich daraus ermessen, dass es in Kairo nicht weniger als mindestens dreihundert Kaffeehäuser gibt, in denen der Unsitte gefröhnt wird. Und zwar sind alle Schattierungen vertreten, von der elenden, schmutzigen Spelunke bis zum grossen Kaffeehause mit Garten, Springbrunnen und in sauberes Weiss gekleideten Dienern.
Haschisch ist eine Gottheit, der meist bei Nacht gehuldigt wird. Erst wenn der letzte Schein der Abendröte vom Himmel verschwunden ist und nachdem die mahnende Stimme des Muedsin die Gläubigen zum Nachtgebete gerufen hat, schleichen die Liebhaber des narkotischen Rausches der Stätte ihrer nächtlichen Vergnügungen zu. Vorsichtig verhüllt der ägyptische Grosskaufmann sein Haupt, ängstlich hält sich der Bey oder Pascha ein Taschentuch vors Gesicht, sobald sie hastig durch einen Nebeneingang ihr Lieblingskaffeehaus betreten. Es könnte ja jemand sie erkennen und dann würde ihnen der Name eines Haschasch ihr Lebenlang anhaften, ein Titel, der für orientalische Ohren etwa dasselbe bedeutet, wie Trunkenbold für die unsrigen. Bald herrscht dann ein reges Leben und Treiben im Gärtchen des Kaffeehauses. Die Gäste sitzen auf breiten, mit persischen Teppichen belegten Bänken, für den Kahwagy (Kaffeehauswirt) hat man noch ein Schaffell ausgebreitet, dessen Wolle mit der beliebten Hennah schreiend rot gefärbt ist. Mit untergeschlagenen Beinen sitzt er da, an eine Truhe von sorgfältig eingelegter Damaszener Arbeit gelehnt, der grosse Gafaw, dessen Kaffeehaus als das beste von ganz Kairo gilt. Ein kleiner Mann mit klugen, braunen Augen. Die zahllosen Falten und Fältchen seines pergamentenen Gesichtes bekunden, wie sehr er gelebt, geliebt, genossen das irdische Glück.
Um ihn und neben ihm gruppiert sich der Kreis der Stammgäste: Da ist Sid Fatih, der Aelteste der Gewürzkrämer des Bazars, eine Art ägyptischer Beau-Brummel in prachtvollen Seidengewändern, da ist ferner Ibrahim Bey, der einmal in Konstantinopel war und dessen eifrigstes Bemühen es seitdem ist, die steife Grandezza und erkünstelte Würde der grossen türkischen Seigneurs täuschend nachzuahmen. Da ist Abu el-Fadl, ein Europäer, der aber mit dreissig Jahren die reformierte Kirche verlassen und sich zum Islam „bekehrt“ hat; ein Sonderling, der die Sitten und Gebräuche des Ostens praktisch studiert, sich einen bescheidenen Harem hält und bereits zum Grabe Alys gepilgert ist. Da hockt der Pilger Yaha, ein frommer Schneider, der dreimal schon zum „Hause Gottes“ nach Mekka gewallt ist. Jedesmal schwor er sich, nach seiner Rückkehr dem verbotenen Kraute zu entsagen, und jedesmal brach er seinen Schwur. Da ist ferner der feiste Ferid Effendi, ein schlimmer Jüngling aus alter Familie, ein Wüstling, dem man böse Laster nachsagt. Einige geschwätzige Kopten, ein schäbiger Schriftgelehrter mit mächtigem Turbane, der Possenreisser des Kreises und einige Orientalen niederer Bedeutung vervollständigen die Gesellschaft.
Jeder Gast erwirbt bei seinem Eintritte vom Wirte einige Stücke (tamyrah) des schokoladenfarbigen Harzes, von denen je eines zur Füllung einer Pfeife ausreicht. Diese Pfeife (gosah) besteht aus einer halb mit Wasser gefüllten Kokosnussschale, in die ein, etwa eineinhalb Meter langes, ausgehöhltes Zuckerrohr gesteckt ist, ein zweites, ganz kurzes Ebenholzrohr trägt senkrecht den Pfeifenkopf aus gebrannter Tonerde. Seines strengen Geruches wegen raucht man Haschisch nie allein, sondern auf einer Unterlage, bestehend aus einem Gemisch von Honig und einem schwarzen, schweren Tabak, dem Hassan Kef. Auf diese Unterlage wird ein Würfelchen des hartgetrockneten Harzes gelegt, einige glühende Holzkohlen darauf getan und die Pfeife ist bereit. Ein Diener – in der Regel wählt man dazu schöne Knaben, schlohweisse Tunesier oder Türken – reicht die brennende Pfeife im Kreise herum, jeder Gast tut zwei oder drei tiefe Züge, den kühlen, aromatischen Rauch dabei in die Lungen einziehend und dann eine gewaltige Rauchwolke durch die Nase ausstossend. So folgt Runde auf Runde und bald beginnt sich die Wirkung des betäubenden Genussmittels in dem Benehmen und auf den Gesichtern der Raucher zu zeigen.
Der Einfluss des Narkotikums ist je nach Temperament des Rauchers und der Grösse der genossenen Dose und der Art ihrer Zubereitung ein ganz verschiedener. Nach den ersten Zügen schon bemächtigt sich ein angenehmes Wohlgefühl des ganzen Körpers, eine Art süsser, wollüstiger Müdigkeit, dabei steigert sich die Tätigkeit des Gehirns, ganze Gedankenreihen werden blitzschnell durchdacht, geistige Bilder von seltener Schärfe und Lebhaftigkeit wechseln in kaleidoskopischen Reigen. Bei vorgeschrittenem Stadium des narkotischen Rausches stellt sich eine gewisse Geschwächtheit ein, das Bedürfnis zu reden um jeden Preis, dazu eine Neigung zu unmotiviertem Lachen. Es ist das der risus sardonicus, das kalte, rein körperliche Lachen, ohne seeelische Ursache.
In diesem Stadium lieben es die Raucher, sich an den berüchtigten schlüpfrigen Erzählungen des Orients zu ergötzen, Erzählungen, im Vergleich zu denen die Anekdötchen des Pester Caviar eine elende Spielerei sind.
Aber auch auf das Sexualsystem hat der Haschischgenuss eine belebende Wirkung. Frauen ziehen das Geniessen des Haschisch dem Rauchen fast immer vor, denn es gibt davon auch in Form von harmlos aussehenden Kuchen, Zuckerbohnen, Pillen und Getränken. Auch als dünne Stäbchen, die man in Zigaretten steckt, verschmähen die listigen Haremsschönen seinen Genuss nicht. Sie sind es ja auch nur allzu häufig, die ihre Männer dazu ermuntern.
Wird aber das Rauchen zu weit getrieben, so stellen sich leichte Vergiftungserscheinungen ein: der Blick wird starr und ausdruckslos, die Sprache schwer und lallend, im Gegensatz zur Alkoholvergiftung sinkt der Pulsschlag beträchtlich, und der Berauschte verfällt in einen bleiernen Schlaf.
Der erste Zustand ist der verführerischste, der Geist scheint gleichsam vom Körper losgelöst, wir empfinden ein Gefühl der Leichtigkeit und Unkörperlichkeit, welcher unwillkürlich die Illusion des Fliegens und Schwebens, wie auf purpurnen Aetherwellen, hervorruft. Erhaben ob Raum und Zeit empfinden wir die im Fluge verstreichenden Stunden wie ebensoviele Minuten. Regungslos, sprachlos sitzt der Raucher da, im stummen Glücke. So tief ist er in sich selbst versunken, dass er bei jeder Berührung durch die Aussenwelt wie in tötlichem Schrecke auffährt: Der übertriebene Haschischgenuss erzeugt ein unheimliches Angst- und Furchtgefühl.
Dem schon genannten Abu el-Fadl fiel einmal inmitten seiner Träumereien eine grosse schwarze Bohne aus dem geheimnisvoll rauschenden Blättergewirr in den Schoss. Der Träumer schaute die harmlose Frucht einen Augenblick verstört an, dann stiess er einen grauenvollen Angstschrei aus, rannte taumelnd einige Schritte und brach dann zusammen. Man brachte ihn bald wieder zur Besinnung und seine erste Frage war: „Der Skorpion, ist er tot?“ Er hatte in seinem narkotischen Rausche die Bohne für einen jener totbringenden Skorpione gehalten, die gelegentlich in menschliche Wohnungen dringen.
Man wandelt eben nicht ungestraft unter Palmen, und das Glück ist ein flüchtiger Schatten, es lässt sich nicht für ein paar Piaster kaufen.“

Ein verheißungsvolles Antidepressivum scheitert in der entscheidenden Studie. Der Fall zeigt erneut, wie wenig verstanden die Chemie des Gehirns ist. (Telepolis v. 22.11.2011)
Therapeutische Wahrheiten und Illusionen
Zu den Ursachen der weltweiten Pandemie psychischer Krankheiten. (Telepolis v. 14.08.2011)
Placebos ohne Täuschung. Jetzt ist es soweit: Placebos wirken selbst dann, wenn die Patienten wissen, dass sie ein Scheinmedikament einnehmen. Oder nicht? (Telepolis v. 29.04.2011)
Länger leben durch Vitaminzusatz? Hilft die Einnahme von Antioxidantien? (Telepolis v. 25.01.2013)
Krebs und seine Metastasen: Es ist alles viel komplizierter
Die verschiedenen Zellen eines Tumors haben oft mehr genetische Unterschiede als Gemeinsamkeiten. (Telepolis v. 16.03.2012)
Hoffnung für Zuckerkranke
Die Entwicklung der „künstlichen Bauchspeicheldrüse“ macht Fortschritte. (Telepolis v. 13.12.2011)
Kleine Geschenke begründen die Freundschaft
Weltweit haben Medizinstudenten schon früh Kontakt zur pharmazeutischen Industrie
(Telepolis v. 02.06.2011)
Marketing statt Evidenz: Durch Gerichtsverfahren veröffentlichte Dokumente zeigen die gewieften Methoden der pharmazeutischen Industrie (Telepolis v. 09.03.2010)
Innovationsmangel: Big Pharma sucht nach Orientierung
(telepolis v. 13. August 2008)
Placebos: Warum der Schein besser wirkt als nichts (DIE WELT v. 11. Juli 2008)
Subjektiver Rausch und objektive Nüchternheit
Der Medizin-Anthropologe Nicolas Langlitz über das Forschungs-Revival psychedelischer Substanzen, die objektive Erkenntnis subjektiven Erlebens und kulturell beeinflusste Psychopharmakawirkung. (Telepolis v. 12.01.2012)
Zur philosophischen Basis heutiger Drogenpolitik: Interview mit Michael Rinella über das Symposion und Platos Neueinordnung der Ekstase (Deutsch & english version).
„Salvia ist keine Eskapisten-Droge“
Interview mit Daniel Siebert, dem weltweit führenden Experten für Salvia divinorum, dem sogenannten „Wahrsagesalbei“ (and here is the english version)
Alte Pflanzen, neue Heilung?
Interview mit dem Experten für historische Pharmakologie Werner Dressendörfer
Der Körper geht sich selbst
Interview mit dem Buchautoren Hans-Christian Dany über die Rolle von Amphetamin in der modernen Gesellschaft
„Eine integrale Drogenpolitik wäre weit von einer generellen Drogenfreigabe entfernt!“
Interview mit dem Psychologen Wulf Mirko Weinreich über das Bewusstseinsmodell von Ken Wilber, die Zukunft der Drogenkultur und die psychotherapeutische Praxis
„Die Verelendungsprozesse hören nur durch die Vergabe von Methadon oder Heroin nicht auf“
Interview mit dem Bremer Suchtforscher Heino Stöver
Chemische Kriegsführung
Der Psychiater James S. Ketchum �ber seine Experimente im Dienste der US-Armee mit Belladonnoid-Glycolaten und LSD
Zur Neurobiologie der Alkoholabhängigkeit
Interview mit dem Suchtforscher Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie der Berliner Charité
Die Heroinabgabe muss kommen
Interview mit Henning Voscherau über synthetische Opiate vom Staat und die erreichbaren Ziele der Drogenpolitik
Von einem, der auszog, …
Baba Rampuri spricht über die Welt der Yogis (and here is the english version)
Der ewig missachtete Richterspruch
Staatsanwalt Carsten Schäfer über seine Max-Planck Studie zu Cannabiskonsum und Strafverfolung in den Bundesländern
Evolution
Interview mit dem Buchautoren und 68er-Veteranen Bruno Martin
Der Bandit von Kabul
Jerry Beisler im Gespräch über den Haschisch-Trail und das Afghanistan der 70er Jahre
„Kunst war mir immer suspekt“
Interview mit dem visionären Künstler Fred Weidmann
MAPS: Psychedelika als Therapie
Interview mit Rick Doblin, Gründer der „Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies“, über MDMA und die Probleme bei der Arbeit mit psychoaktiven Substanzen
Halluzinogene in der praktischen Forschung
Interview mit Prof. Charles Grob über seine Studien mit MDMA und Psilocybin.
(Hier die englische Version)
Aus den Tiefen
Interview mit Amon Barth
Annäherung an das richtige Leben
Interview mit Wolfgang Sterneck
Wenn der Konsum zum Problem wird
Interview mit dem Psychiater Eckart Schmidt über starke Cannabis-Raucher
Die Hanfapotheke
Franjo Grotenhermen spricht über ein Projekt, in dem Kranke Cannabis bestellen können.
Grenzwertig: Fahren und Gefahren mit THC
Interview mit dem Rechtsanwalt Martin Krause über Cannabis und eine kraftfahrzeuggestützte Lebensweise.
„Der Leistungssport wird seine ‚Unschuld‘ nie wieder zurückgewinnen“
Interview mit Günter Amendt, Experte für Drogenökonomie und Drogenpolitik, über Doping, die Pharmakologisierung des Alltags und das Scheitern der Prohibition.
Natur und „research chemicals“
Interview mit Jon Hanna, Herausgeber der Psychedelic Resource List, über den globalen ethnobotanischen Markt.
„Wir haben in unserer Gesellschaft insgesamt ein Problem mit dem Genießen“
Interview mit Prof. Gundula Barsch, Mitglied der Nationalen Drogen- und Suchtkommission im Bundesgesundheitsministerium über ihr Konzept der Drogenmündigkeit.
Dem Kiffer (mit Problemen) kann geholfen werden
Interview mit dem Suchttherapeuten Helmut Kuntz.
Interview mit Tilmann Holzer vom „Verein für Drogenpolitik“
Holzer spricht über das „Cannabis-Regulierungsmodell“ des Vereins.
Interview mit Joseph R. Pietri, dem „König von Nepal“
Der Haschisch-Schmuggler spricht über seinen Job.
Interview mit Nol van Schaik
Der Coffee-Shop Aktivist über die Praxis des niederländischen Modells.
Interview mit Gerhard Seyfried
Die Comic-Ikone über seine neue Lust am Schreiben.
„Rauschkultur als Form der Religiösität und des Hedonismus“
„Die soziale Realität muß die Normen durch Lächerlichkeit aushebeln“
Zwei Gespräche mit Professor Sebastian Scheerer, Kriminologe an der Universität Hamburg. Es geht um den Streit um das Cannabiskraut, das Urteil des Verfassungsgerichts, die Drogenpolitik in Deutschland und die Auswirkungen von Drogen auf das Bewusstsein.
Interview mit Ronald „Blacky“ Miehling
Der ehemalige Kokainhändler Ronald Miehling hat über Jahre den deutschen Markt mit Kokain versorgt.
Interview mit Christian Rätsch
Christian Rätsch -der wohl anerkannteste Ethnobotaniker Deutschlands- im Gespräch. Esoterischer Schamanenkult, psychoaktive Pflanzen, „Das Gute“, „Das Böse“ und Richard Wagner sind Themen.
Interview mit Wolf-Dieter Storl
GRÜNE aufgepasst: Dieser Pflanzenkenner und -lauscher weiß, was man von Pflanzen lernen kann.
„Ich sehe keine Bewegung“
„Sind wir durch mit dem Interview?“
Zwei Gespräche mit Hans-Georg Behr, dem zornigen Hanf-Veteranen. Der kiffende Psychiater hat eine bemerkenswerte Art, seine Meinung auszudrücken…
Mr. Cannabusiness
Interview mit Frank Zander, dem Organisator der grössten Hanfmesse Deutschlands.
„Wir nutzen nicht das, was in den Drogen steckt“
Interview mit Horst Bossong, dem früheren Drogenbeauftragten der Hansestadt Hamburg.
Gespräch mit Renate Soellner
Autorin der Studie „Abhängig von Haschisch? Cannabiskonsum und psychosoziale Gesundheit.“
„Unglücklicherweise wissen wir nicht genug über Cannabis, dabei wäre es einfach heraus zu finden.“
Interview mit Jonathan Ott, Autor des Buches „Pharmacotheon“.
(Hier die englische Version)
„Techno, Tanzen, Törnen, Ficken – Wegbereiter der Extase“
Interview mit dem Eve&Rave Urgestein Hans Cousto
Von alten und neuen Hexen und einem neuen Naturverständnis
Interview mit der Ethnologin Claudia Müller-Ebeling
Vom Wandeln zwischen den Welten
Schamanismus-Expertin Nana Nauwald im Interview
Pilzmännchen und Freiheitskappen
Interview mit Roger Liggenstorfer zum Thema psilocybinhaltiger Pilze
Der ganze Drogenkrieg kippt…
Hanf- und Verschwörungs-Experte Mathias Bröckers im Gespräch
Hanf – Eine Nutzpflanze unter vielen?
Ein Interview mit Hanf-Forscher Michael Karus, Geschäftsführer des nova-Instituts
Der umfassende Einblick in die Welt der psychoaktiven Substanzen: Alle Specials (mit aktuellen Ergänzungen) von az, dazu weitere Artikel aus Magazinen, Zeitungen und Online-Medien.
Absinth, Alkohol, Argyreia nervosa, Ashwaganda, Ayahuasca, Bananenschalen, Betel, Damiana, Designerdrogen, Ephedra, Fliegenpilz, GHB ( 1.4 Butandiol), Ginkgo, Ginseng, Kawa Kawa, Ketamin, Koffein, Kaffee, Kokain, Krähenaugen, Lactucarium, LSD, Modafinil, Nachtschattengewächse, Oxy, Oxytocin, Pilze, Placebo, Ritalin (Methylphenidat), Salvia, Schlafmohn, Tabak, Teufelsdrogen (Yaba, Speed), Viagra, Yohimbe, Zigaretten.
Das Drogenverbot ist (mal wieder) am Ende
Der hochtechnisierte und globale Markt produziert ständig neue Substanzen, eine Kontrolle wird immer schwieriger (Telepolis v. 21.06.2012)
Ecstasy und seine Kinder
Mal wieder schafft eine Drogenstudie mehr Verwirrung als Aufklärung. (Telepolis v. 18.04.2012)
Das Ende der Akzeptierenden Drogenarbeit? Ein Abgesang
Abstinenz: Von der christlichen Idee zur Richtlinie der Politik
Klassifikation von Drogen: Britische Experten urteilen neu
Regulierungsmodelle: Wie der Staat mit Cannabis umgehen sollte
Bedenklich: Cannabis auf dem Schulhof
Wie stellt sich die Cannabis-Szene die Legalisierung vor? Legal, aber wie?
Wo ist wieviel erlaubt? Gesetze und Realitäten des Hanfkonsums in Europa und Osteuropa
Zu Besuch beim Organisator des Hamburger Hanffest: „Wir wollen uns zeigen.“
Ergo: Thesen zur Drogenpolitik
Die europäische Drogenbeoachtungsstelle legt ihren Bericht für 2007 vor
Same procedure as every year
Die Wiedergeburt einer alten Bekannten
In Afghanistan wird wieder Haschisch produziert
Gefahr im Paradies
Thailand im Wandel
Mal ganz unten, mal ganz oben, aber immer: Kokain
Eine Polemik zum Fall Kate Moss
Die Weltreligionen und ihr Verhältnis zum Rausch
Teil 1: Das Christentum, Teil 2: Der Hinduismus, Teil 3: Der Islam,
Teil 4: Der Buddhismus, Teil 5: Das Judentum
Chemie-Apotheken schließen
Research Chemicals
Ritualgruppen und neue Kirchen nutzen den Trank als Sakrament:
Ayahuasca kommt in den Großstadtdschungel
Weltweite Cannabis-Politik und ihre Missachtung:
Arizona, Australien, Großbritannien, Costa Rica, Indien, Kanada, Vietnam, USA, Europa, Ost-Europa
Grasgeflüster:
Auf welchen Routen reisen Haschisch und Marihuana?
Ausführliche Rezension eines Buches von Alfred McCoy:
Die CIA und die Drogenbarone
Spice: Aufstieg einer dubiosen Psycho-Droge (telepolis v. 22.02.2009)
Das Ying und Yang der Cannabis-Psychose
Berauschende Aromaten?
Welchen Anteil kann ätherisches Hanfblütenöl an der psychoaktiven Wirkung von Rauschhanf-Präparaten haben?
Internet:
Sicheres Surfen und das Posten in Grow- und Drogen-Foren
In medias res:
Das Graslexikon und das Haschlexikon
Handwerk:
Die Growing-Area
Vorsicht :
Cannabis und der Führerschein
Welche Fehler Kiffer in Polizeikontrollen und danach machen.
Mangelhaft:
Ein Test mit Drogentests
Schädlich:
Cannabis und die Lunge
Ein Vergleich der giftigen Inhaltsstoffe von Cannabis und Tabak
Cannabinoid-Arzneimittel im Aufwind:
Man hofft auf das große Geschäft
This will get you medicated!
In den USA hat sich Cannabis als Medizin längst durchgesetzt
Viel THC, aber auch Mikroben
Uni Leiden untersucht Coffee-Shop-Cannabis
Antiseptisch:
Zu Besuch bei THC-Pharm
Verdampfung:
Universität Leiden testet den Vaporizer
Feinstofflich:
Die Forschung zu den Cannabinoiden
Alltag:
Cannabis in der Praxis medizinischer Anwendung
Interview über Cannabis in der Medizin
mit dem Apotheker Manfred Fankhauser
Interview mit Lester Grinspoon
über Cannabis als Medizin
Interview mit Franjo Grotenhermen,
dem Vorsitzenden der „Internationalen Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin“
Portrait des Künstlers und Rock’n’Rollers Helmut Wenske
Eine kurze Geschichte der Orgie
Albert Hofmann: Zum Tod des Chemikers und Naturphilosophen
Männer & Rausch Warum wir?
Halluzinogene Fische? Ein Mythos?
Nautische Architektur: Die Kunst des Mathias Erbe
Fressflash: Wenn der Rausch im Essen deponiert wird
Die ultimative Pfeifenkritik
Der ebenso ernst zu nehmende Psychotest
Mattscheibe:Kiffen und Kiffer im Film
Netzwerkpartys: Im LAN-Wahn
Eine satyrische Bilanz zur hundertsten Ausgabe des Magazin „Hanfblatt“
Wahrer Trash: Ein Bericht vom Cannabis-Kongress
Nachruf auf Timothy Leary
20 Jahre als Head-Shop Besitzer
Mit einem Fan auf dem Hamburger Hanffest 2000
Verkostung beim Nachtschattenmagier:
Miraculix aus Winterhude
Historische Kultur:
Deutsche Anti-Marihuana-Krimis aus den 50ern
Als die Bayern auszogen den Weltmarkt mit Haschisch zu überfluten
Marihuana in den Groschenheften der Sechziger Jahre
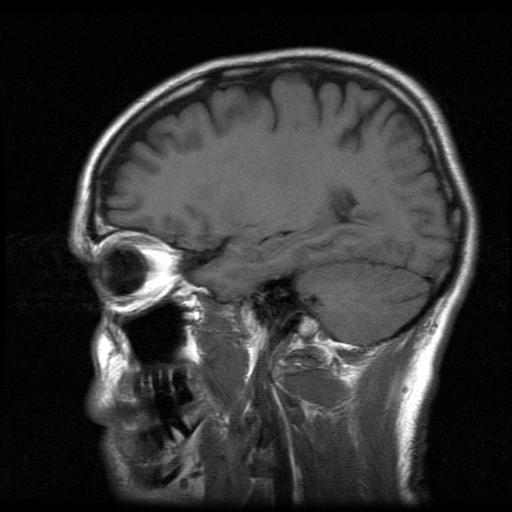
Mittlerweile gilt in Wissenschaftskreisen als gesichert, dass Cannabis-Konsum eine latent vorhandene Psychose zum Ausbruch bringen kann. Zwar ist nur etwa ein Prozent der Bevölkerung anfällig für diese Krankheit, wer allerdings in dieser Gruppe kifft, erhöht sein Risiko, dass eine Psychose tatsächlich ausbricht. Nun finden sich unter Psychosepatienten häufig Cannabiskonsumenten. Dies wurde bislang als Beweis für die schlechte Eigenschaft von Cannabis angesehen. Andererseits wurde zugleich darauf hingewiesen, dass viele Patienten die Substanz als Selbstmedikation nehmen, weil die beruhigende und sedierende Wirkung von Cannabis schätzen. Zwei britischen Wissenschaftler haben sich in einer neuen Untersuchung (British Journal of Psychiatry, 192/2008, S. 306-307) auf die Spur dieses widersprüchlichen Phänomens gemacht.
Ihre Ausgangsvermutung: Je höher der Anteil des sogenannten Cannabidiol in dem Gras, desto geringer die Chance ein unangenehmes Erlebnis beim Kiffen zu haben. Neben dem bekannten, psychoaktiv wirkenden THC gilt Cannabidiol als ein nicht psychoaktives und daher vernachlässigbares Cannabinoid. Celia Morgan und Valerie Curran analysierten die Haare von Cannabiskonsumenten. Danach teilten sie die Gruppe in drei Subgruppen auf: Diejenigen, die nur THC im Haar hatten (N=20, 7 Frauen, 13 Männer, Durchschnittsalter=26), diejenigen, bei denen sowohl THC als auch Cannabidiol im Haar gefunden wurde (N=27, 21 Männer, 6 Frauen, Durchschnittsalter=27) und solche, die keine Cannabinoide im Haar hatten (N=85, 27 Frauen, 58 Männer, Durchschnittsalter=26). Die Konsumneigung in den beiden Subgruppen mit Cannabinoiden im Haar war etwa gleich stark ausgeprägt. Mit einer psychologischen Testbatterie überprüften die Autoren sodann die Neigung der Probanden zu unangenehmen Erlebnissen währen des Rausches. Und siehe da: Die Subgruppe, die nur Spuren von THC und keine Cannabidiole im Haar sitzen hatten, berichteten eher von unschönen Sinnestäuschungen sowie Freud- und Lustlosigkeit. Anders herum formuliert: Ein hoher Anteil von Cannabidiol im Cannabis lässt den Rausch sicherer werden.
Die Autoren sehen in ihrer Studie einen Beweise dafür, dass der Konsum unterschiedlicher Sorten von Cannabis zu unterschiedlichen psychologischen Erlebnissymptomen führt. Man kann noch einen Schritt weiter gehen. Seit Jahren beschweren sich einige Cannabis-Connaisseure über Gras mit zu hohem THC-Gehalt, gemeinhin als Psycho-Gras bezeichnet. Zeitgleich wurde immer deutlicher, dass zum einem neben dem THC andere Cannabinoide zur ausgewogenen Gesamtwirkung von Cannabis beitragen, zum anderen das Cannabidiol höchstwahrscheinlich antipsychotische Eigenschaft besitzt. Wer den Bogen noch weiter spannen will, der kann sogar darauf hinweisen, dass Morgan und Curran kaum Unterschiede in der Psychose-Empfänglichkeit zwischen den THC-Cannabidiol- und den Ganz-Ohne-Was-im-Haar-Probanden fanden.
Eine wichtige Einschränkung der Studie existiert allerdings: Die Studienteilnehmer wurden alle aus einer Langzeitstudie von aktueller und ehemaliger Ketamin-Konsumenten rekrutiert. Um die Ergebnisse zu erhärten soll die Studie daher mit Personen wiederholt werden, die nur Cannabis konsumiert haben. Ansonsten gilt weiterhin: Es existiert ein Beziehung zwischen Cannabis und dem Ausbruch einer Psychose, aber eben keine kausaler Zusammenhang. Das Eintrittsalter und die genetische Veranlagung spielen eine wichtige Rolle. Eine Studie mit 3500 Jugendlichen zeigte 2005, dass die Personen, die Cannabis bereits im Alter von unter 16 Jahren konsumierten, ein signifikant höheres Psychoserisiko auswiesen als Jugendliche, die erst später kifften. Eine weitere Studie konnte zeigen, dass die Menschen, die eine bestimmte Variante des COMT (Catechol-O-Methyl-Transferase)-Gens besitzen,ebenfalls ein höheres Risiko tragen, an einer Psychose zu erkranken, wenn sie in ihrer frühen Jugend Cannabis konsumieren.

In der Diskussion um die Gefährlichkeit des Cannabiskonsums ist ein Argument immer wieder zu hören: Marihuana-Rauch sei mit erheblich mehr giftigen Inhaltsstoffen belastet als Tabakqualm. Eine Studie im Auftrag des kanadischen Gesundheitsministeriums fand nun heraus: Das stimmt so nicht.
Für den Versuch nutzte man getrocknete Cannabisbuds der Firma Prairie Plant Systems, die ihm kanadischen Saskatoon für das Gesundheitsministerium Cannabis anbaut. Sowohl der Marihuana-Spliff als auch die Tabak-Zigarette wurden von standardisierten Rauchmaschinen eingeatmet, die den menschlichen Lungenzug recht gut imitieren.
Zieht man normal an einer Zigarette oder an einem Spliff fluten etwa 40 mg Teer in die Lunge, dies ist bei beiden Rauschdrogen ähnlich. Zieht man stark, strömen rund 80 mg Teer bei der Zigarette und rund 100 mg Teer beim Spliff ein. Dieser Unterschied in der Menge hängt wahrscheinlich mit dem unterschiedlichen Abbrennprozess der Pflanzenteile zusammen. Ein deutlicher Unterschied ergab sich bei Ammoniak. Dieses wurde in einer etwa 20-mal so hohen Konzentration im Cannabis gefunden. Das ist wahrscheinlich durch die sehr nitrathaltigen Düngemittel bedingt. Aber auch die Höhe der Verbrennungstemperatur spielt eine Rolle bei der Ammoniakbildung.
Auch andere Verbindungen wurden im Cannabisrauch verstärkt nachgewiesen: Blausäure (HCN) kam rund 2,5 mal so oft vor, Stickstoffmonooxid (NO) in etwa 4-mal so hoher Konzentration. Dazu waren einige aromatische Amine in 3- bis 5-mal so hoher Konzentration wie im Tabakrauch vorhanden. Schwermetalle wie Kadmium, Quecksilber und Blei wurden dagegen im Marihuanaqualm im Vergleich in deutlich niedrigeren Konzentrationen gefunden. Auch dies hängt vermutlich mit den Anbaumethoden zusammen. Wird Tabak wird nämlich auf Böden angebaut, der mit Schwermetalle kontaminiert ist, nimmt die Pflanze diese Stoffe auf. Die Spliffs enthielten im Vergleich zu den Zigaretten zudem geringere Konzentrationen an niedrigmolekularen Carbonyl-Verbindungen wie Formaldehyd und Azetaldehyd, sowie an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Die kanadische Studie um ihren Autor David Moir bestätigt frühere Experimente, die im Cannabisrauch viele der gleichen Chemikalien wie im Tabakrauch gefunden haben. Eine Bewertung der vorhandenen Unterschiede ist daher nicht einfach. Zunächst muss festgestellt werden, dass die Verbrennung von Tabak- oder Marihuana-Pflanzenmaterial eine komplexe Mischung von Chemikalien hervorbringt, deren Zusammenspiel noch nicht vollständig verstanden ist. Sodann ist zu konstatieren, dass es darunter Substanzen gibt, die aufgrund ihrer krebserzeugenden Eigenschaften in besonders schlechtem Ruf stehen. Neben Teer sind das vor allem die Schwermetalle und die Nitrosamine. Letztere kommen im Marihuanaqualm nicht vor. Das nicht als krebserregend, sondern als „krebserregend-verdächtig“ beschriebe Formaldehyd kommt in beiden Zigarettenarten vor, allerdings etwas niedrigeren Werten im Gras. Dagegen ist das erhöhte Vorkommen der giftigen Blausäure im Cannabisrauch beunruhigend. Die kanadischen Forscher wollen nun in einem neuen Experiment die Toxizität von Tabak- und Marihuana Rauchkondensaten in drei verschiedenen biologischen Systemen testen.
Eine Verbindung zwischen Krebs und dem Rauchen von reinem Marihuana ist bislang nicht bewiesen. Aufatmen kann da kein Kiffer, denn die westeuropäische Konsumkultur mischt ja bekannterweise zumeist Marihuana oder Haschisch mit Tabak zu den beliebten Joints. Die kanadische Studie zeigt erneut, dass diese Sitte der Gesundheit abträglich ist, denn so mischen sich auch die gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe der beiden Pflanzen.
Jörg Auf dem Hövel
Um die aufsehenerregende Entwicklung in der neuesten Cannabisforschung zu verstehen ist zunächst ein kurzer Ausflug in den medizinischen Sektor nötig: Die Hauptwirkstoffe der Cannabis-Pflanze werden Cannabinoide genannt. Im Körper jedes Menschen sind kleine Empfangsstationen in den Zellmembranen dafür zuständig, dass die Cannabinoide ihre Wirkung entfalten können. Diese Stationen werden Rezeptoren genannt. Die meisten psychoaktiven Substanzen wirken über solche Rezeptoren, indem sie an sie binden oder sie blockieren und damit die Signalweiterleitung beeinflussen. Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entdeckten Forscher ein ausgedehntes System von Rezeptoren, das primär der Aufnahme der Cannabinoide zu dienen schien. Man nannte es das „endogene Cannabinoid-System“. Die Auswirkung dieser Entdeckung und Namensgebung fängt man erst heute langsam an zu begreifen. Denn im Laufe der Zeit entstand ein ganzer Forschungszweig, der sich nur mit diesem System beschäftigte. Eine neue Welt tat sich auf, Konferenzen wurden abgehalten, Universitäts-Abteilungen beantragten Gelder.
So schön der Mythos klingen würde: Die Cannabinoid-Rezeptoren sind von der Evolution nicht nur dafür geschaffen worden, um Cannabis aufzunehmen. Allen Forschern war Anfang der 90er Jahre klar: Wie bei allen anderen Rezeptoren auch musste ein körpereigener Stoff existieren, der eine bestimmte Funktion an diesen Rezeptoren erfüllt. 1992 entdeckte der tschechische Chemiker Lumír Hanuš und der amerikanische Molekularpharmakologen William Anthony Devane diese Substanz im Körper und nannte sie „Anandamid“. Eine mehr oder minder feine Ironie, denn im Sanskrit steht das Wort „Ananda“ für die Glückseligkeit.
Weltweit forschte man in den Laboren der Pharma-Firmen und Universitäten weiter, nun galt es, die Cannabinoid-Rezeptoren genauer zu untersuchen. Man entdeckte zwei Arten, diese werden heute als CB-1 und CB-2 Rezeptoren bezeichnet. Ersterer findet sich vorwiegend in Nervenzellen. Am häufigsten kommt er im Kleinhirn und im Hippocampus (eine Sektion im Großhirn) vor. Der CB-2 findet sich dagegen vorwiegend in den Zellmembranen des Immunsystems und auf Zellen, die am Knochenauf- und -abbau beteiligt sind. Es wird vermutet werden, dass weitere Sub-Rezeptoren für Cannabinoide existieren. Diese beiden Rezeptoren sind Ziel der Entwicklung von neuen Wirkstoffen und damit letztlich neuen Medikamenten. Für Kranke lockt Linderung, für die Pharma-Industrie ein Riesengeschäft. Wie immer, wenn neue Medikamente in Aussicht stehen, vermischen sich Wünsche, Prognosen und Versprechungen. Fakt ist: Alleine im Markt der Appetitzügler haben über zehn Unternehmen Wirkstoffe entwickelt und in der Prüfung, die am CB-1-Rezeptor ansetzen. Abbildung 1 zeigt den Aufschwung, den dieser Forschungszweig seit 2000 erfahren hat.
Versuche wirksame Appetitzügler herzustellen gab es viele: Amphetamin (Speed) galt in den 40er und 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als probates Mittel, um den Hunger zu stillen. Bei regelmäßig-übermäßiger Einnahme, so stellte man fest, überwogen allerdings die negativen Langzeitwirkungen. Bis heute weisen viele der auf dem Markt befindlichen Appetitzügler eine ähnliche chemischen Struktur wie Amphetamin auf. Nur haben sich die Chemiker darum bemüht, die psychoaktiven Wirkung zu eliminieren. Ein solcher Wirkstoff ist beispielsweise Fenfluramin, einer anderer Phentermin. In den USA kam es Anfang der 90er Jahre zum sogenannten „Fen-Phen“- Debakel, weil die beiden Medikamente von Patienten parallel eingenommen wurden und es zu Herzbeschwerden kam.
Ein Problem ist: Die zugrunde liegenden Mechanismen der körpereigenen Regulation von Nahrungsaufnahme und Sättigungsgefühl sind erst in Ansätzen verstanden. Die fresslustzügelnden Eigenschaften von Speed basieren auf der Hemmung des Hungerzentrums im Zwischenhirn. Aber die auf Amphetamin beruhenden Medikamente haben unerwünschte Nebenwirkungen. Aus diesem Grund und weil die Pharma-Industrie naturgemäß immer auf der Suche nach neuen Verkaufsschlagern ist geriet Cannabis in den Fokus.
Die Überlegung der Pharmakologen: Wenn Cannabis den Appetit über die Cannabinoid-Rezeptoren anregt, dann müsste eine Blockierung des Rezeptors den Hunger zügeln. Solche Blockierer werden Antagonisten genannt. 1994 synthetisierten Wissenschaftler beim Pharma-Konzern Aventis einen einen CB-1-Antagonisten und nannten ihn „Rimonabant“. Dieses Medikament ist bis heute in Europa zum erfolgreichen Appetitzügler geworden. Wie so oft treten aber Nebenwirkungen auf, in den USA ist das Medikament daher nicht zugelassen. Auch in Europa sollen Langzeitstudien klären, ob Rimonabant gefahrlos länger eingenommen werden kann. Glaubt man den Studie, verlieren fettleibige Patienten in Rimonabant-Therapie tatsächlich an Gewicht.
Seit dem Erfolg von Rimonabant ziehen die anderen Firmen nach. Merck & Co. entwickeln Taranbant, Pfizer einen Stoff mit dem Arbeitstitel CP-945598. Die Blockade des Cannabinoid-Rezeptors bringt aber nicht den Vorteil der Hungerreduktion. Der Rezeptor ist eben nicht nur für den Appetit, sondern für andere Mechanismen im Körper zuständig, so kommt es, dass Testpersonen immer wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, wenn sie CB-1-Antagonisten einnehmen. Eine Erklärung ist: Die Euphorie, die beim Konsum von Cannabis verspürt wird, schlägt bei der Blockade des dafür zuständigen Rezeptors ins Gegenteil um. Fest steht bisher nur, dass ein Eingriff in das cannabinoide System des Menschen weitreichende Folgen haben kann. Trotz dieser Hindernisse haben heute diverse Pharma-Firmen und Biotechs Patente auf CB-1 und CB-2 Blocker oder Enhancer eingetragen.
Sativex
Expertise im Cannabinoid-Markt hat sich die britische Firma GW Pharmaceuticals erarbeitet. Mit „Sativex“, einem Mundspray, haben sie das einzige Cannabinoid-Produkt auf dem Markt, welches aus organischem Material hergestellt wird. GW hat die Erlaubnis Cannabispflanzen in großen Mengen anzubauen. Mit jedem Spraystoß liefert Sativex 2,7mg THC and 2,5mg Cannabidiol an den Patienten. Bis heute ist es nur in Kanada zugelassen und auch nur bei Patienten mit Multipler Sklerose. In anderen Ländern laufen Genehmigungsverfahren, um Sativex als Schmerzmittel zuzulassen. Auch GW Pharmaceuticals arbeitet an einem Appetitzügler, dieser basiert auf einer Unterart des THC, dem Tetrahydrocannabivarin (THC-V). Dieses gewinnt GW ebenfalls aus den eigens angebauten Pflanzen. Wie das oben erwähnte Rimonabant gilt THC-V als CB-1-Antagonist, allerdings als natürlich vorkommender.
Die Analyse des endogen cannabinoiden Systems fokussierte sich bis 2006 vor allem auf den CB-1-Rezeptor. Neuere Forschung zeigen nun, dass der CB-2 Rezeptor eine wichtige Rolle bei einigen Körperfunktionen spielt: Knochenschwund im Alter (Osteoporose), Modulationen des Immunsystems, Nervenentzündungen, Schmerzempfinden. Schon jetzt zeigt sich aber: Die für die Medikamentenentwicklung so wichtigen Tierversuche sind hier wenig aussagekräftig, weil Ratten und Mäuse anders auf CB-2-Substanzen reagieren als Menschen. Dazu kommt: Weder Cannabis noch die cannabinoiden Agonisten oder Antagonist wirken zielgenau in nur bestimmen Regionen des Körpers oder Gehirn, wenn auch die Pharma-Industrie gerne von „hochselektiven Wirkstoffen“ spricht. Nein, das System Mensch wird in seiner Gesamtheit geflutet, so kommt es zu chemischen Kaskaden bei Botenstoffen, deren Ausgang nur durch Trial and Error heraus gefunden werden kann. Die Naturmedizin hat ein solches Verfahren über die Jahrhunderte an Millionen von Menschen angewandt, die moderne Pharmazie arbeitet dagegen mit 1000 Probanden, die einen Wirkstoff über einen kurzen Zeitraum erhalten.
Fazit
Die Entdeckung des cannabinoiden Systems ist aus vielerlei Gründen ein Meilenstein. Zum einen kann die wissenschaftliche Erforschung der Wirkung von Cannabis fortschreiten. Die verschiedenen Pflanzenwirkstoffe scheinen für diverse Vorgänge im menschlichen Organismus mitverantwortlich zu sein. Die Geschichte hat die breite Anwendungsmöglichkeit von Cannabis gezeigt, nun wäre es Aufgabe der modernen Forschung, dieses alte Wissen in moderne Medizin umzusetzen. Das Problem: Moderne Medizin heißt heute meist Pharmakologie. Pharma-Unternehmen sind in erste Linie an patentierbaren Wirkstoffen interessiert und werden daher alles versuchen, die natürlich vorkommende Wirkstoffe zu diskreditieren. Der euphorisierende Effekt von natürlichen Cannabisprodukten wird daher weiterhin als unerwünschte Nebenwirkung beschrieben werden. Mit viel Aufwand versucht man heute in den Labors, die psychoaktive Wirkung der Cannabinoide zu eliminieren und ein Reinprodukt zu erhalten, dass zielgenau nur bestimmte Bereiche des menschlichen Organismus beeinflusst. Die Geschichte der Medikamente zeigt aber nur zu deutlich, dass solche Bemühungen nur mit neuen Nebenwirkungen erkauft werden. Aber das Marketing der Pharma-Firmen wird dieses Phänomen weiterhin zu kaschieren wissen. Die Apologeten einer naturnahen medizinischen Anwendung des Hanfs, so traurig dies ist, werden unter den Bedingungen der heutigen Marktwirtschaft auch weiterhin als Kifferfreunde abgestempelt werden. Zukünftig werden diverse Medikamente auf den Markt stoßen, die das cannabinoide System zum Ziel haben werden. Zu einer Rehabilitierung der Pflanze wird das aber nicht führen.
]]>
zurück zur Startseite von Jörg Auf dem Hövel mit weiteren Interviews und Artikeln

Trotz einer mittlerweile etablierten Forschung über die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten von Cannabis überwiegen Vorurteile gegenüber dem Hanf als Heilmittel. Es soll an dieser Stelle nicht die Diskussion um die historischen Wurzeln des Heilmittels Cannabis aufgerollt werden. [1] Fest steht, dass die Produkte der Hanfpflanze über Jahrhunderte, ja, Jahrtausende von den Menschen in ganz unterschiedlichen Regionen des Globus genutzt wurden. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde Cannabis ideologisiert und dämonisiert und in Folge dessen aus den medizinischen Lehrbüchern gestrichen.
Genauso wenig allerdings wie ein Verbot die Genießer und Neugierigen abschreckt, so verhindern unsinnige Gesetze, dass kranke Menschen auf der Suche nach Gesundheit und Wohlbefinden sich der Pflanze zuwenden.
Ideologisch präformierte Wissenschaftler suchen mit finanzieller Unterstützung puritanisch-kapitalistischer Konzerne und einer verblendeten Politik seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Entbehrlichkeit von Cannabis nachzuweisen. [2] Erfolglos.
Um es kurz zu machen: Heute werden die medizinischen Effekte von Cannabis nach dem Etablierungsgrad ihrer Nachweisbarkeit eingeordnet [3]. Als etabliert gilt die Wirksamkeit gegen Übelkeit und Erbrechen und damit gegen Essstörungen und den damit verbundenen Gewichtsverlust. Als relativ gut gesichert gelten die Effekte bei Spastiken, Schmerzzuständen, Bewegungsstörungen, Asthma und dem Glaukom (Grüner Star). Als weniger gut gesichert gilt die Wirksamkeit bei Allergien, Juckreiz, Infektionen, Epilepsien, Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeit und Entzugssymptome.
Von der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis einmal ganz abgesehen: Trotz der Ergebnisse der Forschung sieht die Politik keinen Anlass kranken Menschen den Zugang zu einem preiswerten und offensichtlich wirksamen Medikament zu gewähren. Man fürchtet den Dammbruch und sieht hinter den Argumenten der Medizinalhanf-Befürworter nur eine weitere Taktik, um der Legalisierung eines Rauschmittels Vorschub zu leisten.
Soviel vorweg. Um die Diskussion nicht nur den akademischen, parlamentarischen und berufsgenossenschaftlichen Zirkeln zu überlassen, ist es nötig die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die Hanf als ihre persönliche Medizin bei einer schweren Krankheit anwenden. In der Juli Ausgabe suchten wir darum HanfBlatt-Leser und Leserinnen, die Cannabis als Medizin anwenden. Es meldeten sich daraufhin über ein Dutzend Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemen im physischen und psychischen Bereich. Ihre Geschichten sollen hier Thema sein.
Günther [4] aus Berlin beispielsweise wurde (wie viele andere auch) lange nicht von seinem Arzt ernst genommen. Anfang 1994 setzte bei ihm plötzlich tägliche Kopfschmerzen ein, zudem Verspannungen in der Halsmuskulatur. Ein Neurologe diagnostizierte später einen spastischen schiefen Hals (Cervicale Dystonie). Dabei zieht der rechte Halsmuskel den Kopf nach rechts weg, ständiges Kopfzittern und Schmerzen sind die Folge. Die chemische Keule sollte es -wie so oft- richten: Aber diese Schmerzmittel sind unglaublich stark. Wenn ich die nehme, dann liege ich den ganzen Tag betäubt im Bett, berichtet Günther.
Dann erinnerte er sich an seine Jugendzeit und die entspannende Wirkung von Haschisch. Ein Freund besorgte mir was zu rauchen, ich rauchte das Haschisch und eine halbe Stunde später war das Reißen und Zittern fast weg.
Seit dieser Zeit gestaltet sich der Tagesablauf von Günther immer ähnlich: Nach dem Aufstehen raucht er ein Gramm Cannabis und für rund vier Stunden sind seine Schmerzen gelindert. Gegen 15 Uhr nimmt er die zweite Dosis des Tages zu sich, gegen 20 Uhr die letzte. Es verwundert mich immer wieder, wie entspannend und krampflösend dieses Mittel ist, sagt Günther. Über eine lange Versuchsreihe sei er auf diese Dosierung gekommen: Mehr Rauchen bringt nicht mehr Linderung.
Durch die ständige Schiefhaltung des Kopfes sind Wirbelsäule und die Halswirbel verschoben. Da die Krankheit zur Zeit nicht heilbar ist, bezieht Günther EU-Rente an eine regelmäßige Arbeit ist nicht zu denken. Früher konnte ich nicht mal auf die Straße raus, heute schaffe ich das, zwar in Begleitung, aber immerhin. Und auf den Grad der Verbesserung angesprochen, sagt Günther: Wenn es früher 100% Krankheit waren, dann sind es heute 60%.
Dem Architekten sei Dank: Günthers Balkon ist auf der Südseite seiner Wohnung es herrschen optimale Bedingungen für die Hanfzucht für den Eigenbedarf.
Seine Ärzte wunderten sich über Günthers Genesung, bis er das Geheimnis aufklärte: Die sagen jetzt, ich soll es nehmen, wenn es denn hilft. Trotz der Besserung ist Günther alle drei Monate auf Spritzen mit dem Nervengift Botalinum Toxin angewiesen. Davor graut mir jedes Mal. Danach kann ich nicht richtig schlucken und um überhaupt Essen zu können muss ich enorm viel trinken. Zudem treten durch die Injektionen in die Halsmuskulatur zeitweise Lähmungen an Armen und Beinen auf.
Die Nebenwirkungen von Hanf stuft er dagegen als gering ein. Ein Rauschempfinden stelle sich für ihn kaum noch ein. Losgelöst, aber nicht high, fühle er sich, aber der Rausch geht in den Muskel und die Entspannung. Das Verbot von Cannabis hält der Mann für unsinnig. Letztlich kann ich nur jedem raten, der Spastiken hat, es mit Cannabis zu probieren.
Von Seiten einer pharmazeutisch orientierten Wissenschaft wird die unspezifische Wirkung von Marihuana oder Haschisch hervorgehoben. Obwohl mittlerweile als gesichert gilt, dass die synthetisch hergestellten Hanf-Ersatzmittel mit diversen Nebenwirkungen aufwarten, sieht dieser Zweig der Forschung den Einsatz von Marinol und Dronabinol als die ultima ratio an. Naturnahe Pflanzenmedizin, die ihre Wirksamkeit gerade aus der Kombination diverser Bestandteile zieht, scheint diesen Forschern keine Alternative. Das Gegenteil beweist Olaf aus Wolfsburg, der bereits im zweiten Lebensjahr an Morbus Chron erkrankte.
Morbus Chron ist eine chronische Entzündung des Verdauungstraktes, deren Ursachen weithin unbekannt sind. Deshalb beschränkt sich die Therapie auf die Behandlung der Symptome, die sich in immer wiederkehrenden starken Bauchkrämpfen, Durchfällen und Gewichtsabnahme ausdrücken. In Deutschland schätzt man die Zahl der Erkrankten auf etwa 300.000. Olaf ist einer von ihnen.
Seit dem Ausbruch der Krankheit habe ich Cortison bekommen, zunächst wenig, später bis zu 120 Milliliter täglich, erinnert sich Olaf. Neben dem Cortison wurden Beruhigungsmittel verabreicht. Die Krankheit verschlimmerte sich so sehr, dass sich Olaf mit 14 Jahren einer komplizierten Operation des Dickdarms unterzogen wurde. Ein halber Meter des mit Geschwüren übersäten Verdauungsorgans wurden heraus geschnitten.
Mit 16 habe ich dann zufällig mit Freunden Haschisch probiert und die Koliken verbesserten sich noch am selben Abend. Zunächst glaubte er an einen Zufall, aber eine Wiederholung des Experiments zeigte die wiederum die Entkrampfende Wirkung der Wirkstoffe des Cannabis-Produkts. Was als netter Abend begann wurde so zur Institution. Ich rauche rund ein Gramm Haschisch vermischt mit Tabak am Tag.
Seine Eltern klärte er früh auf, sie reagierten gelassener als der damalige Arzt: Der lief brüllend durch die Praxis und rief: <Mein Gott, ich habe einen Kiffer als Patienten>, erinnert sich Olaf amüsiert. Seine aktuellen Ärzte können sich die Wirkung des medizinal eingesetzten Rauschhanfs nicht erklären, wollen die Anwendung aber auch nicht ablehnen. Schließlich hilft es besser als alles andere zuvor, sagt Olaf. Heute benötigt der 27-Jährige nur noch bei akuten Kolik-Schüben Cortison. Dann aber auch nur noch 20 Milligramm. Insgesamt hätten sich, so Olaf, die Krämpfe, aber auch seine mentalen Probleme enorm verbessert:
Seit ich Cannabis rauche hat sich mein Leben in die richtige Bahn geleitet.
Methadon ist zur Zeit das Mittel der Wahl bei der Behandlung heroinabhängiger Menschen. Viele berichten aber von Übelkeit und Erbrechen nach der Einnahme der Substanz. So erging es auch Nils aus Recklinghausen, der fünf Jahre lang Heroin konsumiert hatte, bevor er mit dem Ersatz-Opiat therapiert wurde. Wenn ich Methadon morgens nahm, dann habe ich sofort gekotzt. Eine Freundin erzählte ihm von der Wirkung von Cannabis, Nils probierte eine Tüte vor der Methadoneinnahme, und mir war zwar immer noch leicht schlecht, aber kotzen musste ich nicht mehr. Heute dosiert er sich morgens mit einem Joint mit rund 0,1 g gutem Haschisch. Abends kommt etwas mehr in die Tabak-Mischung, rund 0,4 g. Blöd ist natürlich, dass ich morgens schon immer stoned bin. Ich stehe deswegen um 6 Uhr auf, damit ich nach dem ersten Rausch arbeiten kann.
Der Herr Doktor von Nils sieht die gestiegenen THC-Werte des Patienten gelassen. Allen Methadonsubstituierten die kiffen, denen gehe es besser, soll er gesagt haben. Wenn Cannabis legal wäre, würde mein Arzt mir das verschreiben, behauptet Nils sogar. Ähnlich lässig reagierte vor einiger Zeit ein Polizist, der Nils mit etwas Haschisch in den Taschen erwischte. Der hat nur kurz daran gerochen und es mir wieder gegeben. Ob es an Haschisch-Beikonsum liegt oder nicht, zumindest ist Nils entschlossen, nie mehr Heroin zu nehmen.
Mögen auch noch so viele Betroffene von ihren individuellen Heilerfolgen mit Cannabis berichten Schulmedizin, Wissenschaft und Politik nennen diese Erfahrungen gemeinhin anekdotisch und sprechen ihnen ein Potential zur Verallgemeinerung ab mit fatalen die Folgen für den Einzelnen. Gesetze und tradierte Forschungsparadigmen führen dazu, dass in Deutschland keine systematische Erforschung der positiven Wirkungen des naturbelassenen Rauschhanfs existiert. Ein Skandal, wenn man denn so will, und so nimmt es kein Wunder, dass an allen Ecken der Republik erkrankte Lebewesen die Gesetze ignorieren.
So auch Kurt aus Bremen. Er leidet seit 1995 an chronischer Hepatitis C, einer Entzündung der Leber. Abgeschlagenheit, chronischer Durchfall und schnelle Ermüdbarkeit, nennt er als Symptome. Neben der medikamentösen Behandlung, einer sogenannten Interferon Alpha Therapie, versuchte es Kurt auch mit Mariendiestel ohne Erfolg. Besserung trat erst auf, als er eine Kombinationstherapie mit Interferon, Pegintron und Rebetol aufnahm. Die Nebenwirkungen der Medikamente führten allerdings zu starker Appetitlosigkeit und Depression. So sollte Cannabis helfen und es half, wie der 38-jährige Mann erzählt.
Dies ist kein Einzelfall. In der Redaktion meldeten sich drei Personen, die ihre Hepatitis C mit Cannabis behandeln. Karl aus Herne beispielsweise lindert damit nicht nur die Nebenwirkungen der Medikamente, inhalierter Marihuanarauch führt bei ihm dazu, dass die typischen Symptome der Hepatitis, nämlich ständige Müdigkeit und Erschöpfung, eingedämmt werden. Nach dem Rauchen habe ich kaum noch Schweißausbrüche bei Körperbewegungen, erzählt er. Alle drei bis vier Stunden raucht Karl, 35, einen Joint, wobei die Dosis des Hanfkrauts niedrig ist: Ich muss bei weitem nicht soviel rauchen, dass ich stoned bin am Tag komme ich mit einem Gramm Gras aus. Die Justiz hatte im letzten Jahr kein Verständnis für den ungewöhnlichen Medikamentengebrauch von Karl. Ein Richter verurteile ihn wegen des Besitzes von Cannabis zu einer Bewährungsstrafe.
Der Hanf als Stimmungsaufheller, als Beschwichtiger des großen Kummers, wie es in Indien heißt, ist bekannt. Gegen den Alltagsfrust kann ein Pfeifchen helfen, wie sieht es aber mit wirklich schweren psychischen Beeinträchtigungen aus? [5] Zumindest bei Christine aus Hamburg half Cannabis, neben anderen Maßnahmen, bei der Wiederentdeckung der Freude. Die Studentin litt lange an einer endogen Depression, sah nur noch wenig Sinn im Leben und fühlte sich in ihrem Körper gefangen. Sie berichtet: Mit 18 bin ich aus eigenem Antrieb heraus zu einem Psychiater gegangen, der mir Fluctin/Prozac verschrieben hat. Die Wirkung hat auch eingesetzt und ich nahm die Welt eine Weile mit einer rosaroten Chemiebrille wahr. Neue Wege haben sich mir dadurch nicht eröffnet. Später lernte Christine Cannabis kennen, kiffte viel und verdrängte mit exzessiven Konsum die Depression, ohne sich deren Ursachen zu nähern. Es ist bestimmt nicht empfehlenswert nonstop breit zu sein, nur um sich nicht selbst begegnen zu müssen, weiß sie heute. Trotzdem hält sie Haschisch für einen Schlüssel für ihre Gesundung. Ich habe durch Kiffen und Tanzen gelernt, mich wieder um meinen Körper zu kümmern. Der entscheidende Knackpunkt sei aber eine homöopathische Therapie gewesen. Noch heute raucht sie täglich, ist sich der Nebenwirkungen (Verpeiltsein) zwar bewusst, will aber noch nicht aufhören. Das Verhältnis zu ihrem Arzt ist gut: Er wusste von Anfang an Bescheid über meinen außerordentlichen Cannabiskonsum und hat betont, er habe da nix gegen, nur dass ich es benutzen würde, um was anderes zu überdecken, wäre nicht in Ordnung, womit er auch recht hat. Trotzdem sieht sie sich selbst heute als weitgehend gesund an. Ich habe einen langen Weg hinter mir, doch heute atme ich ein, ich atme aus und bin, was ich bin.
Um Irrtümer zu vermeiden: Das Voranstehende soll nicht dazu führen in Cannabis das allheilende Wundermittel zu sehen. Gerade die psychischen Krankheiten sind weder in ihren Ursachen noch in ihrer Therapierung hinreichend erforscht. Immer mehr in den Vordergrund rückt allerdings, dass monokausale Ursachen selten sind. Um das eine Krankheit umgebenen Geflecht aus physischen und psychischen Wurzeln zu entwirren ist meist kompetente Hilfe notwendig. Aber wer ist kompetent?
Die aufgeführten Fälle zeigen neben dem Mut der Menschen die Hilflosigkeit der Ärzte, die der cannabinoiden Zusatztherapie ihrer Patienten bisweilen akzeptierend, gelegentlich ablehnend, immer aber ratlos gegenüber stehen, weil auch sie, die vermeintlichen Experten, keine hinreichenden Informationen zu diesem Naturstoff haben. Damit ist auch die Problemlage eines Gesundheitssystems angesprochen, welches im ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnis zur pharmazeutischen Industrie steht. Dass aber die legale Chemie alleine nicht allen hilft steht fest. Für den Einzelnen auf der Suche nach einer umfassenden Behandlung seiner Krankheit bleibt daher oft nur der Gang in die Illegalität.
Die unbestreitbaren positiven Effekte der Cannabinoide im Körper dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Einzelne auch mit diesem Medikament verantwortungsvoll umgehen muss, um den Erfolg nicht in eine Schaden umkippen zu lassen. Denn nicht allein die Dosis bestimmt das Gift, auch die mentale und soziale Verfasstheit des Konsumten. Positiv ist daher die Zielgerichtetheit, mit der die hier beschriebenden Patienten Cannabis anwenden. Obwohl das hedonistische Spektrum der Droge bekannt ist, liegt der Augenmerk bei ihnen deutlich auf der Linderung der Krankheit. Und, wenn diese persönliche Bemerkung erlaubt ist, das HanfBlatt wünscht auf diesem Wege weiterhin gute Besserung!
[1] Siehe dazu C. Rätsch: Hanf als Heilmittel.
[2] Das immer noch erschreckenste Beispiel hierfür ist das in seiner Fülle von angehäufter Desinformation beispiellose Buch von Peggy Mann: Haschisch. Zerstörung einer Legende. Bitte nicht kaufen, höchstens mal zu Ansicht ausleihen!
[3] Vgl. zum folgenden Franjo Grotenhermen: Cannabis und Cannabinoide. 2001, Bern: Hans Huber. Für einen Überblick über Hanf als Medizin siehe auch Lester Grinspoon: Marihuana Die verbotende Medizin. 1994, Frankfurt a.M.: 2001, zudem http://www.cannabislegal.de/cannabisinfo/medizin.htm und die Seite der Arbeitsgemeinschaft für Cannabis als Medizin unter http://www.acmed.org/.
[4] Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.
[5] Einen Überblick gibt http://www.chanvre-info.ch.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen