HanfBlatt, Nr. 67/2000
SALVIA DIVINORUM
Lieferant des stärksten aus dem Pflanzenreich bekannten Psychedelikums
Das, was das Gewebe der Realität zerreißt. Salvinorin A. Vorweg: Salvia Divinorum unterliegt in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz. Aber wir wollen die Pflanze kennenlernen, die uns diese bemerkenswerte Substanz liefert.
Salvia divinorum ist eine einzigartige psychoaktive Salbeiart, auch „Wahrsagesalbei“ genannt, die in den Bergen von Oaxaca, einem mexikanischen Bundesstaat, von Mazateken Indianern, die sie „Hierba de la Pastora“ (Kraut der Schäferin) oder „Hierba de la Virgen“ (Kraut der Jungfrau) nennen, für schamanische Rituale gezogen wird. Echte Wildvorkommen sind nicht bekannt. Sie wird nur über Stecklinge (Klone) vermehrt. Praktisch alle im Umlauf befindlichen Stecklinge sollen von nur zwei lange auseinanderliegenden Sammlungen im Herkunftsgebiet abstammen. Man spricht vom sehr bitteren Wasson & (Albert) Hofmann – Klon und dem wohl verbreiteteren Palatable – Klon. Ein wahres Klonwunder also, daß sich gegenwärtig auch hierzulande im Kreise experimentierfreudiger Psychonauten eines regen Interesses erfreut. Die Pflanze ist nicht ganz anspruchslos, was ihre Wachstumsbedingungen betrifft. Sie liebt es warm bei hoher Luftfeuchte und guter Wasserversorgung, viel Licht, aber keine direkte Sonnenbestrahlung und kein Frost, halt so wie in der juten alten Heemat, dem tropischen Bergland der Sierra Mazateca. Wer auf diese Ansprüche Rücksicht nimmt, wird mit schnellem Wachstum belohnt. Das nicht sonderlich attraktive großblättrige Gewächs kann zwei bis drei Meter hoch werden. Auch lassen sich relativ problemlos Stecklinge gewinnen. Im Wasserglas beginnen sie nach zwei bis drei Wochen zu wurzeln.
Der Eigenanbau lohnt, denn im ethnobotanischen Fachhandel werden für 1 Gramm der getrockneten Blätter Preise von durchschnittlich 5 bis 8 DM verlangt. Und ein innerhalb von weingen Monaten auf 1 bis 1,5 Meter hochgeschossener Steckling, kann locker 20 Gramm und mehr getrockneter Blätter liefern. Für Stecklinge werden Preise von durchschnittlich 35 bis 40 DM verlangt. Dabei sollte unbedingt darauf geachtet werden, daß es sich um gesunde grüne, möglichst gut angewurzelte Exemplare handelt. Sie überstehen keine langen Transportzeiten und werden im Falle des Versandes, sofort nach dem Auspacken in eine Umgebung hoher Luftfeuchte verbracht, zum Beispiel in eine Art Reanimationszelt aus durchsichtiger, noch luftdurchlässiger Kunsttofffolie. Regelmässiges Übersprühen mit kalkfreiem Wasser tut es auch. Im Winter stagniert bei uns das Wachstum, wenn man keine künstliche Beleuchtung einsetzt. Im Frühling treiben die Pflanzen wieder aus. Deshalb werden auch Stecklinge meist erst ab dem Frühjahr versandt.
Die Blätter werden üblicherweise während der wärmsten Jahreszeit, also bei uns im Sommer oder Spätsommer geerntet. Ihr Wirkstoffgehalt scheint dann am höchsten zu sein. In den Tropen gewachsene Salvia divinorum soll potenter sein (bis zum 1,5 fachen). Es können sowohl einzelne Blätter als auch ganze Zweigspitzen geerntet werden. Aus den Seitenachseln treiben dann neue Triebe aus.
Die Blätter werden sofort frisch verwendet oder bei Raumtemperatur getrocknet.
Der nicht wasserlösliche Wirkstoff der Blätter kann nur über die Mundschleimhäute oder die Lunge in ausreichend kurzer Zeit in genügender Menge resorbiert werden, um die für einen intensiven Effekt notwendige Schwellendosis im Körper zu überschreiten. Dazu werden verschiedene Einnahmemethoden praktiziert.
1. Die frischen Blätter werden zu einer Art Zigarre gerollt und in die Backe(n) gequetscht, ausgedrückt, zerkaut, wobei man darauf achtet, daß möglichst viel Saft möglichst lange mit den Mundschleimhäuten in Berührung kommt. Das Runterschlucken des Saftes wird herausgezögert. Ist man mit dem Kauen durch, kann noch nachgelegt werden. Für einen Kauvorgang sollten 15 bis 30 Minuten veranschlagt werden. Eine typische Dosis sind 10 große Blätter. Die Blätter schmecken charakteristisch, nicht gerade lecker. Sie können auch bitter sein. Wieweit der Gehalt an zusätzlichen Bitterstoffen vom Klonahnen und der Anbaumethode abhängt, ist noch nicht ganz klar. Spaß bringt die Kauprozedur auf jeden Fall höchstens den Zuschauern.
2. Die getrockneten Blätter werden angefeuchtet und wie ein Pfriem in der Backe plaziert und ausgekaut wie die frischen Blätter. Die getrockneten Blätter schmecken vielleicht einen Tick „besser“ als die frischen, aber auch nur einen „Tick“.
3. Die getrockneten Blätter werden in einer Wasserpfeife geraucht. Dabei kommt es darauf an, möglichst viel Rauch möglichst lange und oft hintereinander in die Lungen zu kriegen. Die minimale gerauchte Dosis liegt bei einem halben Gramm der Blätter. Das ist schon „eine ganze Menge Holz“.
4. Es wird ein alkoholischer Extrakt aus den Blättern gewonnen. Dazu weicht man die getrockneten Blätter meherere Tage an einem dunklen Ort in soviel möglichst reinem trinkbarem Alkohol (Weingeist) ein, daß die Blätter bedeckt sind. Schließlich wird abgefiltert. Der erhaltene Extrakt kann nun durch Verdunstenlassen des Lösungsmittels weiter konzentriert werden. Läßt man den Alkohol vollständig abdunsten, erhält man einen schon recht konzentrierten nahezu festen Extrakt, der geraucht werden kann.
Der alkoholische Flüssigextrakt wird eingenommen, indem man ihn entweder leicht verdünnt mit Wasser oder pur ( vorsicht „brennt“) in den Mund nimmt und die Schleimhäute möglichst lange umspülen läßt. Für minimale Effekte sollte der Extrakt mindestens einer Ausgangsmenge von 2 Gramm der getrockneten Blätter entsprechen. Es werden oft viel höhere Dosierungen genommen. Die Potenz des Extraktes ist natürlich auch vom eingesetzten Ausgangsmaterial abhängig. Deshalb sind erhebliche Schwankungen möglich.
Der Festextrakt wird geraucht, indem man ihn möglichst vollständig verdampft und in möglichst wenigen lange einbehaltenen Zügen inhaliert. Auch hier wird das Äquivalent von mindestens einem halben Gramm der Blätter, oft aber eher das von ein bis vier Gramm der Blätter geraucht um eine deutliche Wirkung zu erzielen. Verdampfungsmethoden werden dem banalen Rauchen vorgezogen.
5. Es wird über einen komplizierten Extraktionsprozeß der reine Wirkstoff Salvinorin A gewonnen, beziehungsweise ein hochkonzentrierter Extrakt hergestellt. Der reine Wirkstoff wird von einer ausgeglühten Alu-Folie oder in einer Haschölpfeife verdampft und inhaliert. Die gerauchten Dosierungen liegen zwischen 0,3 und 2 Milligramm, sprich 0,0003 und 0,002 Gramm! Da dies für einen Laien äußerst schwer zu dosieren ist, hat man Salvinorin A auch in einem Verhältnis von 1 zu 25 auf die getrockneten Blätter aufgebracht, von denen dann 25 Milligramm, also 0,025 Gramm, eine typische Rauchdosis darstellen, die in einem Zug inhaliert werden kann. Bislang ist der reine Wirkstoff nur in einer kleinen Szene mehr oder weniger erfahrener Underground-Psychonauten in den USA, insbesondere in Kalifornien, zum Einsatz gekommen. Einer dieser Psychonauten, Mister „D.M. Turner“, hat ein sehr lesenwertes Buch über Erfahrungen mit Salvinorin A geschrieben. („Salvinorin. The Psychedelic Essence of Salvia Divinorum.“ Panther Press, San Francisco, 1996, ISBN 0-9642636-2-9). Ein deutsches Büchlein wird von Herrn Bert Marco Schuldes mit äußerster Spannung erwartet.
]]>
Was hat es nun mit der merkwürdigen Wirkung dieser Pflanze auf sich? Es handelt sich bei dem Wirkstoff Salvinorin A um das stärkste aus der Pflanzenwelt bekannte Psychedelikum. Obendrein noch um ein Diterpen, also eine Substanz, die sich von den anderen bekannten Psychedelika chemisch erheblich unterscheidet.Wie Insider zu berichten wissen, scheinen Erfahrungen mit der Inhalation der geradezu winzigen Wirkstoffmengen von einer solchen Intensität und dermaßen bizarr, außer Kontrolle geraten und beängstigend zu sein, daß kaum jemand Lust auf die Wiederholung eines solchen Törns verspürt. Erfahrungen mit dem reinen Wirkstoff sind bei uns gegenwärtig sehr selten. Dagegen haben sich viele Leute schon durch die erheblich geringer konzentrierten alkoholischen Extrakte oder die Blätter getestet, oder sollte man besser gekämpft sagen?! Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Es scheint so, als müsse man das Gespür für die oft recht subtile Wirkung erst entwickeln. Vielleicht gibt es eine individuelle Schwellendosis. Und selbst wenn soetwas wie ein typischer Salvia-Raum des Bewußtseins erreicht wird, übt dieser auf einen Großteil der Konsumenten keinen sonderlichen Reiz aus. Dann gibt es aber auch wieder die besonders Sensiblen, die sich von der eigenartigen Bilder- und Gefühlswelt, die sich mittels Salvia erschliessen lassen kann, faszinieren lassen und sich zu wiederholten Besuchen aufmachen.
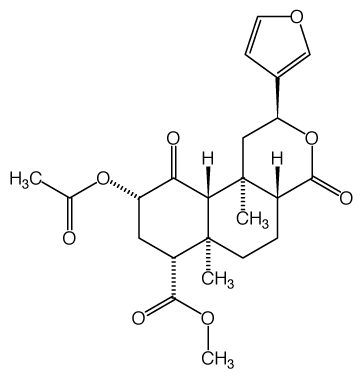
Lassen wir einfach mal einen Experimentierer berichten:
„Mir erging es so, daß ich einige Male mehr und mehr der Blätter oder des Extraktes geraucht und gekaut hatte, und doch schon recht „breit“ wurde, ohne mir darüber klarzusein, wie breit ich eigentlich war. Wenn ich die Augen schloß, spürte ich eine Intensität, die sofort verschwandt, wenn ich die Augen öffnete und mich Vertrautem zuwandte. Ich hatte das Gefühl, immer noch nichtgenug genommen zu haben. Andererseits hatte ich doch deutliche Koordinationsstörungen. Am Telefon lallte ich noch umständlicher als sonst. Musik kam gut. Als ich mir bei einer Gelegenheit im Foyer des Gruner & Jahr-Affenfelsens eine Fotoausstellung ansah, war ich keineswegs außer Kontrolle. Aber der merkwürdige Zustand, in dem ich mich befand, im Kontrast zu dem was ich tat, in Kombination mit dem wohlschmeckenden Lakritzeis, an dem ich wollüstig schleckte, beflügelte mein Amüsement, ohne daß ich genau sagen könnte, wie es mir emotional ging…
Auch die Kombination mit der Inhalation geistbeflügelnder Hanfdämpfe konnte mich nicht vollständig in einen Bereich bringen, den ich endgültig als Salvia-Space akzeptiert hätte, obwohl sie dem Ganzen eine spannendere Note verlieh…
Ein anderes Mal war der Bann dann schließlich doch gebrochen. Mittels des im Mundraum zerfliessenden konzentrierten alkoholischen Extraktes, spät in der Nacht. Ich hatte einen ganzen Film halluzinogener Visionen, insbesondere bei geschlossenen Augen. Und das Ganze von kristallklar kitschig-trivialer Intensität. Szenerien, wie durch ein vorgeschaltetes Auge oder ein Fischauge gesehen, vor einer Kulisse sanft fliessender holzmaserungsartiger Muster mit immer wieder wechselnder Motivwahl, …bunte Fische, spielende Delphine, ein Pingiun auf einer Eisscholle, jetzt sich tummelnde Wale in der Abenddämmerung…Banale graphisch perfekte bunte Bilder aus einer herrlich heilen Welt, aus dem Innern meines Geistes, aber doch auch wie FÜR MICH auf eine innere Leinwand projiziert. Aber auch hier: Beim Öffnen der Augen spüre ich zwar noch die Stärke der Droge, könnte mir aber fast einbilden, völlig nüchtern zu sein, bilde ich mir ein. Wie von selbst schliessen sich die Augen und ich gebe mich der urigen Energie und den eigenartigen Bildern wieder hin. Überraschend, ein schönes beeindruckendes Erlebnis.
Zwei Tage später nochmal mit einer erheblich höheren Dosis. Sofort, der Wunsch aufzustehen, keinen Bock zu liegen und auf Visionen zu warten, zu den anderen ins Wohnmobil rübergehen. Enthemmt, albern, völlig schräge drauf, alles ist schräge, irgendwie auch leicht halluzinogen verändert, schräge eben, auch räumlich, Schräglage. Schön, könnte ruhig noch stärker sein. Die Wirkung ist wie üblich kurz. Vielleicht eine halbe Stunde recht kräftig, nach zwei Stunden verflogen…
Als Nachwirkung hatte ich manchmal leichte Kopfschmerzen, besonders nach der Raucherei.“
Noch ist (mir) nicht klar, wo und wie genau Salvia divinorum und insbesondere der obskure Wirkstoff Salvinorin A in der Familie der Psychedelika einzuordnen sind. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei Salvia divinorum-Konsum nur um eine vorübergehende Modeerscheinung handelt, oder ob sich tatsächlich ein Stamm von Liebhabern etablieren wird. Vielleicht muß tatsächlich erst das morphogenetische Feld für eine Art Salvia divinorum -Konsens-Space erkaut und erraucht werden. Wer weiß? Oder wird gar das reine Salvinorin A als neuer Renner auf dem Markt psychedelischer Möglichkeiten auftauchen? Die Wirkungsbeschreibungen in den vorliegenden Berichten klingen eigentlich nicht so verlockend. Hört sich eher nach kosmischer Verwirrung oder gar psychedelischem Nihilismus an. Sollte das das Ende der Fahnenstange sein? Ich hoffe nicht.
Exkurs:
Die attraktiven Coleus-Arten: Verwandte der Salvia divinorum?
Eine Varietät des schnellwachsenden und wegen ihrer schönen meist mehrfarbigen Blätter als Topfpflanzen beliebten Coleus blumei-Sträuchleins und die weniger bekannte Coleus pumilus gelten bei den Mazateken-Indianern als nahe Verwandte der Salvia divinorum und stehen in einem gewissen Ansehen. Sie werden ähnlich wie diese in Heilungszeremonien eingesetzt, indem man die frischen Blätter zerquetscht und mit Wasser aufgeschwemmt zu sich nimmt oder sie zerkaut, so heißt es. Dieses Wissen animierte Undergrozndfreaks über Jahrzehnte hinweg immer wieder zu fruchtlosen Selbstversuchen mit den bei uns erhältlichen Topfpflanzen. Lasset euch gewarnt sein: Das bei uns gewachsene Coleus blumei-Kraut ist ein Augenschmauß, aber kein Gaumenkitzel. Im Gegenteil: Es schmeckt fürchterlich, und obendrein wirkt es nicht. Auch nicht, wenn man es in getrockneter Form raucht. Die original im tropischen Mexiko gewachsenen Varietäten dagegen sollen tatsächlich, wenn man sie beispielsweise raucht, einen durchaus spürbaren Effekt entfalten. Dafür verantwortliche Wirkstoffe sind bis dato nicht bekannt.
az
Und hier ein Interview mit dem Salvia Experten Daniel Siebert




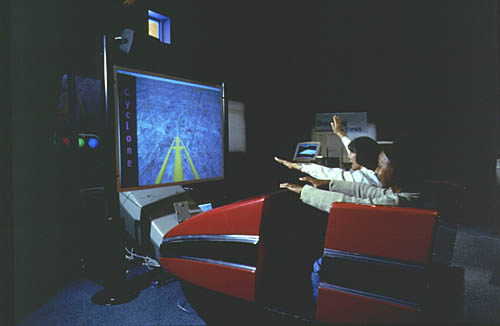






 Wer am Nachmittag des Jahrestags des Erscheinens von Orwells „1984“, am malerischen Wiener Donaukanal flanierte, konnte vor dem Szenelokal Flex die Gruppe temperamentvoller Diskutanden kaum überhören. Berge von Computerausdrucken, Briefen und Notizen auf dem Kaffeetisch vor sich hektisch durchwühlend, wurden neugierige Frager ungewohnt barsch abgewiesen. Doch Wiener Charme milderte die Reaktion: „Normalerweise sind wir viel netter, aber jetzt sind wir im Stress wegen der Preisverleihung heute abend… komm doch heute abend um neun!“ Von einer Jurorin so freundlich eingeladen, wollte man die Auswahl der AwardGekrönten dann nicht weiter stören. Zumal das Flex, das die phonstärkste Anlage Österreichs sein eigen nennt, zur BigBrother Party mit DJ Hell „Eintritt frei“ versprach. Und so ließ man die Jury in Ruhe ihres Amtes walten, die unter anderem aus Vertretern der „Österreichischen Gesellschaft für Datenschutz“ und dem „Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter“ bestand.
Wer am Nachmittag des Jahrestags des Erscheinens von Orwells „1984“, am malerischen Wiener Donaukanal flanierte, konnte vor dem Szenelokal Flex die Gruppe temperamentvoller Diskutanden kaum überhören. Berge von Computerausdrucken, Briefen und Notizen auf dem Kaffeetisch vor sich hektisch durchwühlend, wurden neugierige Frager ungewohnt barsch abgewiesen. Doch Wiener Charme milderte die Reaktion: „Normalerweise sind wir viel netter, aber jetzt sind wir im Stress wegen der Preisverleihung heute abend… komm doch heute abend um neun!“ Von einer Jurorin so freundlich eingeladen, wollte man die Auswahl der AwardGekrönten dann nicht weiter stören. Zumal das Flex, das die phonstärkste Anlage Österreichs sein eigen nennt, zur BigBrother Party mit DJ Hell „Eintritt frei“ versprach. Und so ließ man die Jury in Ruhe ihres Amtes walten, die unter anderem aus Vertretern der „Österreichischen Gesellschaft für Datenschutz“ und dem „Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter“ bestand.




