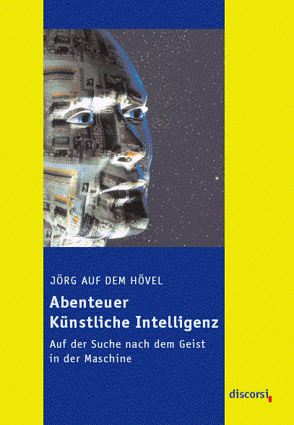HanfBlatt Nr.80, Nov./Dez. 2003
Klar, legal! Aber wie?
Wie würde die Cannabis-Szene die Praxis der Legalisierung von Cannabis gestalten?
Zunächst einmal: „Legalisierung“ ist ein typisches Schlagwort, geeignet Verwirrung zu stiften. Letzlich geht es darum, welche Regulierungen für den Erwerb und Konsum einer Droge, in diesem Fall Cannabis, bestehen. Denkt man sich die Drogenpolitik als ein Spektrum, dann hockt am einen Ende die strikte, immer strafbewehrte Prohibition, am anderen Ende der gänzlich freie Markt. Wie könnte eine Legalisierung des Hanfs praktisch aussehen? Welche Modelle schlummern hierzu in den Schubladen der Ämter, welche Theorien haben die Wissenschaftler? Wichtiger aber noch ist, wie die Cannabis-Szene die Freigabe der pflanzlichen Produkte umsetzen würde. Was sagt der Otto-Normal-Kiffer, was der Dealer, was die Homegrowerin, was der Head-Shop-Besitzer? Ein Lauschangriff ins Herz einer bekifften Republik.
Hört man sich nun in der Szene um, so existieren recht moderate Töne ob der Realisierung der Legalisierung. Nur schrittweise, so meist die Annahme, sei zu erreichen, dass Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz genommen wird. Zunächst sei daher in einem ersten Schritt der Konsums und der Besitz kleiner Mengen für den eigenen Bedarf zu entkriminalisieren. Aber was faällt noch unter Eigenbedarf? Michael, 19-jähriger Gelegenheitskiffer aus Bochum, meint: „Egal, wie man sich hier genau entscheidet, dem Richter eine Wochenration von 500 Gramm verklickern zu wollen, das dürfte schwierig werden.“
An dieser Stelle stellt sich eine Anschlussfrage, auf welche selbst unsere vielzitierten holländischen Nachbarn keine Antwort gefunden haben: Wo kommt das Zeug her? Die niederländische Hanfpolitik regelt zwar den Verkauf im Laden – hier kann jede Volljährige ihr fünf Gramm Beutelchen Marrok erstehen – was aber am Lieferanteneingang abgeht, das will keiner so recht wissen. Cannabis-Händler und Produzenten werden nach wie vor von der Polizei verfolgt. So eine Rechtspolitik nennt man „inkonsistent“ und eine solche ist im braven Deutschland nicht zu machen. Sebastian, 30, Miteigentümer eines Grow-Shops in Hamburg, sagt deshalb: „Der Markt in Holland ist kein peaciges Zuckerschlecken. Es gibt Revierkämpfe, Repressionen und Menschenopfer im Zusammenhang mit dem Handel mit Cannabis. Es muss in Deutschland also darum gehen, den gesamten Schwarzmarkt aufzulösen.“
Konservative Puritaner schlagen noch immer die Hände über dem Kopf zusammen, klügere Menschen ahnen es dagegen schon lange: „Ohne die Legalisierung des Anbaus, des Handels und des Konsums von Cannabis innerhalb bestimmter staatlich kontrollierter Rahmenbedingungen ist ein drogenpolitischer Neubeginn nicht möglich.” So schreibt der Drogenexperte Günther Amendt, 63, in seinem Buch “Die Droge, Der Staat, Der Tod”.
Wenn überhaupt, dann scheint für die verantwortlichen Schlaumeier in Berlin nur eine kontrollierte Marktregulierung denkbar, die zwei Bereiche berücksichtig: Gesundheits- und Jugendschutz. In einem zweiten Schritt könnte daher Cannabis ins Lebensmittelrecht eingeordnet werden. Dieses Recht stellt Cannabis dem Alkohol und dem Tabak gleich, was freilich auch beinhaltet, die Pflanze legal herzustellen und damit zu handeln. Dabei gilt es zunächst zwei Fallstricke zu umgehen.
Es ist zum einen unredlich zu behaupten, dass der Haschisch- und Marihuana-Konsum bei einer Freigabe nicht ansteigen würde. Dies kann keiner so genau wissen. Die Erfahrungen in Holland aber haben gezeigt, dass der Konsum trotz freier Verfügbarkeit nicht angestiegen ist. Autoren wie Amendt gehen davon aus, dass bei einer Freigabe der Gebrauch zunächst ansteigen, später aber wieder abflachen wird, wenn das „verdeckte Nachfragepotential erst einmal abgeschöpft ist“. Gewarnt werden muss auch vor der falschen Hoffnung, die Legalisierung könne den Missbrauch von Hanf vollständig verhindern. Immer wird ein bestimmter Anteil von Menschen den Cannabiskonsum in falsche Bahnen lenken. Vor diesem Hintergrund lassen sich ehrliche Überlegungen über die Praxis der Legalisierung anstellen.
Aus Sicht vieler Kiffer und anderer Experten ist der dritte Schritt den Anbau für den Eigenbedarf zu ermöglichen, wobei sich wieder die Frage der Grenzziehung stellt. Veteranen wie Hans-Georg Behr, Jahrgang 1937, schlagen ein auf fünf Jahre begrenztes Gesetz vor, welches den Anbau von bis zu 50 Hanfpflanzen erlaubt. Bei mehr als 50 Pflanzen wären 7,50 Euro pro Pflanze steuerlich abzuführen. „50 Pflanzen? Damit würde ich schon zufrieden sein“, sagt Lars, Home-Grower in Hannover.
Ein Teil von Wissenschaftler, aber auch der praxisorientierten Kiffer- und Grower-Szene setzt auf das staatliche Monopol für den Hanfvertriebe. Dies verwundert schon, ist es doch dieser Staat, der die Konsumenten nach wie vor mit Strafen belegt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Eine nationale, noch zu gründende Institution könnte die Einfuhr von Gras und Hasch überwachen. Unter Umständen könnte so bereits eine Kontrolle des Anbaus (auch unter ökologischen Gesichtspunkten) in den Rohstoffländern gewährleistet werden. In den Händen dieser Behörde würde auch die Vergabe von Lizenzen zur pharmazeutischen Herstellung von Endprodukten liegen.
Damit ist man beim einem weiteren Vorteil staatlicher Aufsicht: Der Qualitätskontrolle. Schon heute gehört Duft- und Kristallspray zum Inventar einiger skrupeloser Homegrower in Deutschland. Eine Tendenz, die sich bei einer Freigabe des Anbaus wohl noch verstärken würde. Nebenbei bemerkt kann auch hier Holland kaum Vorbild für Deutschland sein. Sebastian vom Grow-Shop: „Die Anbaumethoden werden dort keineswegs vernünftig kontrolliert, die eingesetzten Mittel sind zudem oft gesundheitsschädlich.“ Zunächst einmal muss allen Beteiligten deutlich werden, dass hier keine Rosen, sondern eben ein Lebensmittel gezüchtet wird. Die letzten Lebensmittel-Skandale zeigen die Anfälligkeit der Branche für den unsachgemäßen Einsatz von Chemikalien. Worüber man sich dann aber im klaren sein muss: Ein starkes Kontrollnetz kann nur funktionieren, wenn dahinter ein fetter Behördenapparat agiert.
Ob das wiederum sinnig ist wird von einer anderen Fraktion der Kiffer-Szene angezweifelt. Mehr Staat, so diese Ansicht, dass bedeutet auch mehr Steuern und – fast noch schlimmer – die Gefahr, dass der Staat seiner ewig gärenden Kontrollsucht erliegt. Eine Minimalforderung ist daher – und da sind sich wiederum alle einig – das die Gelder aus Cannabis-Steuern zweckgebunden eingesetzt werden. Alle Einnahmen aus der THC-Besteuerung müssten dann der Rauschkunde-Information und Drogenhilfe zufließen.
Bei aller Vorfreude darf man ruhig über die Nachteile des legalen Hanfs mutmaßen. Es ist nämlich zu befürchten, dass die Tabakkonzerne hier den großen Euro wittern und den Markt mit billigen, qualitativ minderwertigen Joints überschwemmen werden. Wissenschaftler wie Jonathan Ott, Verfasser von „Pharmacotheon“, befürchten bei der Legalisierung von Cannabis eine ähnliche Entwicklung wie beim Tabak: „Legalisiert man Cannabis, würden die großen Tabak-Konzerne den Markt beherrschen. In alten Zeiten war Tabak eine sehr potente, visionäre Droge, später wurde es zu einem Laster: Gerade gut genug um Menschen zu verletzten, aber nicht high zu machen.“
Für Aktivisten und Politiker muss es also darum gehen, dass sich eher eine ausgeprägte Genusskultur wie beim Wein entwickelt, die ihr Heil abseits von industrieller Massenfertigung sucht. Auf der anderen Seite muss sich für die Produzenten die Herstellung von Feinheiten für gehobene Ansprüche lohnen. Ohne hier den Alkohol in die Ecke der dumpfen Bedröhnung stellen zu wollen, ist der Cannabisrausch gleichwohl subtiler und enorm von der Qualität des Produkts abhängig. Es wird immer eine Schar liebevoller Heger und Pfleger geben, die ihren Pflanzen Liebe und Respekt zollen, zugleich werden minderwertige Massenprodukte existierten, die auch aus ökologischen Gründen kräftig anzuprangern sind. Wer preiswerte Ware haben will, der wird auch in Zukunft bei Lidl einkaufen, wer Wert auf Güte legt, der wird in den Fachhandel wandern.
Dies schlägt den Bogen zu dem bewussten Umgang mit diesen Produkten. Wer sich über Sorte, Anbaugebiet, Lage, Erntetechniken, Weiterverarbeitung und Lagerung informiert, der hat schon einen enorm wichtigen Schritt beim Umgang mit einer Droge vollzogen. Man pfeift sich eben nicht irgendeinen Scheiß rein, nur weil es knallt, sondern sucht geflissentlich den gepflegten, kultivierten Rausch. Dies ist letztlich die beste Voraussetzung der vielbeschworenen „Prävention“, die man sich vorstellen kann. Wenn dann noch der Genuss in sozial gefestigten Mustern, eben mit Freunden zusammen, praktiziert wird, dann wird die Chance auf Drogenmissbrauch erheblich minimiert.
Zu einer vernünftigen Aufklärung gehört unbedingt auch der Beipackzettel, der über die Anwendung, Wirkungsdauer, Nebenwirkungen und Kontraindikationen aufklärt. Hier könnte mit wenig Aufwand viel Wirkung erzielt werden.
Zugleich müsste Aufklärung in mehreren Bereichen etabliert werden. In den Familien, den Kindergärten, den Schulen, in der Öffentlichkeit überhaupt muss Cannabis den Menschen wieder näher gebracht werden. Sebastian von Grow-Shop hat die Erfahrung gemacht, dass dies gut über den Anbau funktionieren kann. „Die Eltern begrüßen es eher, wenn der Sohn oder die Tochter mit einer lebenden Pflanze rumhantiert. Da kommt Verständnis auf.“ Denn zum einen, so Sebastian, sind die Kinder aktiv, zum anderen hätten die Eltern das Gefühl größerer Kontrollmöglichkeiten, weil das Kraut in Reichweite wächst. Das sei ihnen lieber, als wenn die Kinder das aus dem Coffee-Shop holen, wo keiner genau weiß, was da drin ist.
Um keine neue Doppelmoral zu etablieren, muss das Informationsmanagement über den Rauschhanf an einer weiteren, entscheidenden Stelle reformiert werden: Es geht einfach nicht an, dass sogenannte Erzieher, Dozenten und Professoren sich als Lehrmeister über Substanzen aufschwingen, die sie nie in ihrem Leben probiert haben. Um jungen Menschen einen sinnstiftenden Gebrauch zu vermitteln, muss der „Lehrer“ einen profunder Erfahrungsschatz mitbringen. Stichwort: Glaubwürdigkeit. Oder bringt man jemanden das Fahrrad fahren durch physikalische Formeln zur Beschreibung der Zentrifugal- und Pedalkraft bei?
Wann darf denn nun eine Heranwachsende mit dem Bong anfangen? Hört man sich in dieser Frage um, so herrscht mittlerweile selbst bei den Hardcore-Befürwortern des Hanfs die Einsicht vor, dass ein zu früher und vor allem zu exzessiver Konsum die persönliche Entwicklung stoppen kann. Kurz gesagt, es traut sich kaum jemand, die Abgabe von Cannabis an unter 16-jährige zu fordern. Der Jugendschutz müsste –so die weiter Meinung- von einem Werbeverbot für Cannabis und dessen Produkte begleitet sein.
Bleibt als letzter strittiger Punkt die Diskussion um die Abgabeorte für das göttliche Ambrosia. Im legendären Apotheken-Modell, das die Gesundheitsministerin von Schleswig-Holstein, Heide Moser, 1997 der erstaunten Öffentlichkeit vorstellte, sollte der Stoff aus dem die Träume sind von Apothekern verteilt werden. Der Gag: Bis 1958 war Cannabis tatsächlich als Arznei in deutschen Apotheken erhältlich. Heute widerstrebt es den Apothekern gründlich, dieses Mittel unters Volk zu bringen – die Apothekerverbände wehren seit Jahren jeden Vorstoß in diese Richtung ab. Auch sonst bleiben viele Fragen offen: Ist Cannabis sodann verschreibungspflichtig? Muss sich der Konsument registrieren lassen? Und warum überhaupt Apotheken? Kurzum: Dem gesamten Ansatz haftet ein etwas akademischer Duft an.
Die meisten Konsumenten sprechen sich daher für ein qualitativ wesentlich aufgebessertes Coffee-Shop-Modell aus. Dazu gehört ihrer Meinung nach eine entsprechende Ausbildung der Verkäufer und die angesprochene Regelung der Anlieferung. Lizenzierte Abgabeorte bedeuten immer auch: Lagerung größerer Mengen und daher Belieferung durch Großproduzenten. Logisch: Dieser Ansatz ist nicht durchzuhalten, wenn nur der Anbau zum Eigenbedarf erlaubt ist. Theoretisch vielleicht noch denkbar, dürfte den Machern in Berlin der Arsch auf Grundeis gehen, wenn sie an die Horden von Kapitalismusverweigerern denken, die sich in solchen Schuppen drängeln würden. Aber da müssten sie durch, die Damen und Herren.
Es ist zu vermuten, dass die Konzessionen für die Eröffnung eines Coffee-Shops (zunächst) heiß begehrt sein werden. Anbieten würden sich die Umfunktionalisierung der bereits bestehenden Head- und Grow-Shops, denn die Menschen hier bringen ihre Drogen-Vorbildung mitein. Aber wann erhält jemand so eine Konzession? Nun, immer dann, wenn eine Eignungs-Prüfung bestanden wird. Folgendes Planspiel ist denkbar: Das zuständige Gesundheitsamt bittet zum führerscheinähnlichen Wissens-Check. Hier muss die Bewerberin beweisen, dass sie THC von TEE unterscheiden kann, den Beipackzettel verstanden hat und ein umfangreiches Wissen über den Hanf und seine Effekte in sich trägt. Diskutierbar ist auch, dass die Konzession nur für ein Geschäft gilt. In jedem Coffee-Shop muss zu jeder Zeit eine amtlich abgesegnete Verkäuferin zugegen sein, ansonsten darf kein Cannabis über die Theke gehen.
Ein so geschnürtes Paket könnte die positiven Potentiale des Hanfs fördern und Gefahren des Konsums mindern, und zu guter Letzt noch die Hoffnung von Henning Schmidt-Semisch, Mitarbeiter am Institut für Drogenforschung der Universität Bremen, bestätigen. Er ahnt nämlich, dass die Legalisierung dem Staat selbst nicht nur aus steuerlichen Gründen nützen würden, sondern auch, „weil sie zu einer Erhöhung der Glaubwürdigkeit staatlicher Drogenpolitik führt“. In diesem Sinne: Rock On!