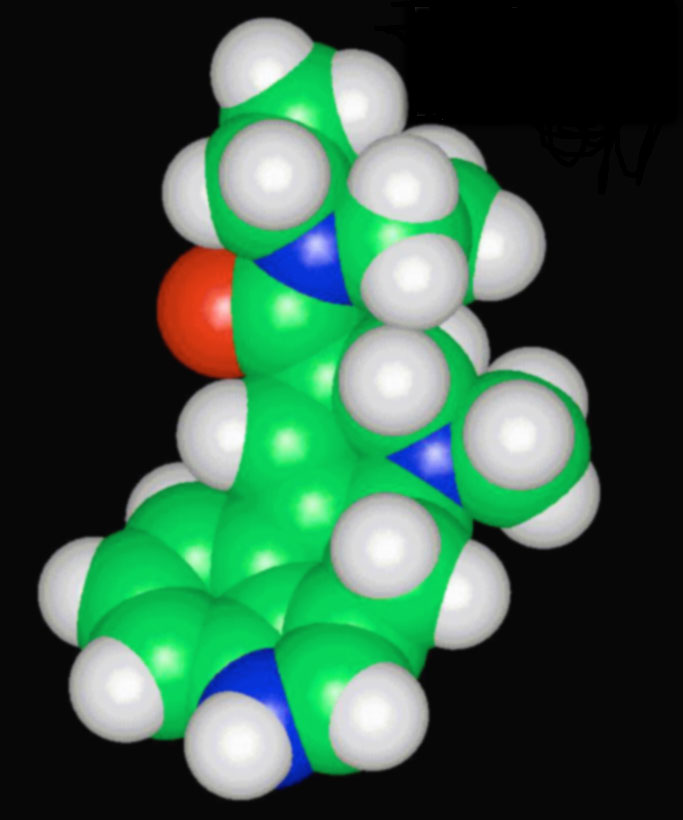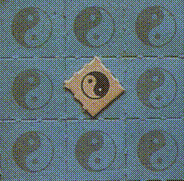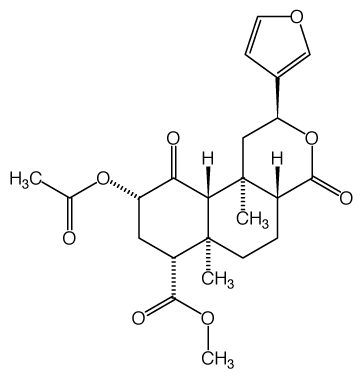HanfBlatt, Nr. 65, Mai/Juni 2000
Hanf im Reisfeld
Marihuana rauchen bringt auch in Vietnam mächtig Spaß – selbst wenn das Kraut nicht wirkt
Die Propellermaschine durchstößt brummelnd den grauen, vietnamesischen Himmel. Unter uns liegt Saigon, vor uns der Urlaub an der Küste von Vietnam. Seit Tagen ist Whiskey fester Bestandteil unserer Ernährung – natürlich nur, um den Magen resistent gegen die ungewohnte Schmarotzer zu machen. So sitzen mein Freund und ich genauso duhn wie degeneriert im wackelnden Flieger der Vietnam Airlines. Liegt es daran, dass sich bei mir alles dreht? Auf alle Fälle wundert mich mal wieder diese merkwürdige Erfindung des rechten Winkels: Häuser, Felder, Strassen – von oben sehen Landschaft und Leben so wohlgeordnet aus. Wo die Natur unbeackert ihrem Dasein nachgeht, wird es runder. Am Boden mäandernde Flüsse, an Bord rosa Damen, die hier Stewardessen von Beruf werden. In den Reihen vor mir nur schwarze Pilze, die wie die asiatischen Beatles auf Tour aus den Kopfstützen wachsen. Ein Fallschirmsprung wäre jetzt geil: Unsere Jungs da unten vor den Schlitzaugen in Sicherheit bringen. Missing in Action VI. Raushauen aus ihren Wasserkäfigen und dann Richtung Kambodscha durchschlagen. Ich beruhige mich wieder von meinem Military-TV-Overdrive. Lieber mal an Jasmin-Blüten denken. Aber neben mir saust der Propeller, zerschneidet Blüte um Blüte. Was ist mit dem Wiskey an Bord? Die Nachschubroute scheint vermint. Egal, O-Saft von rosa Plüschhasen bringt es auch. Ich hoffe sehr, dass diese Gewänder keine Erotikneurosen symbolisieren. Schade, die Wirkung des Alkohols lässt nach. Landung.

Flugabwehrgeschütze am Rollfeld und eine Stadt fast ohne Langnasen, wie die Vietnamesen die hellhäutigen Erdbewohner nennen. An der Strandpromenade wird der Tourismus geprobt: Coca Cola, Langnese, Kioske, Massagen, Maniküre, aber Marihuana? Kein Stress, wir sind ja im Urlaub. Wir ziehen in eine kleine Herberge an der Promenade. Leicht verfallen, die Zimmer muffeln. Ist das der Geruch des asiatischen Sozialismus? Wie auch immer, die Menschen sind neugierig und freundlich. „Where do you come from?“, „How old are you?“ und „What is your Name?“, werden für die nächsten Tage die Einführungssätze in Gespräche, die sich 10 bis 15 mal am Tag wiederholen.
Es wird Abend und damit leider kühl. Am Strand hat es sich eine Gruppe von fünf Typen trotzdem im Kreis gemütlich gemacht. Mein kontaktfreudiger Freund steuert auf die Männer zu und es beginnt ein Austausch von englischen Brocken. Ich sitze etwas schüchtern daneben. Der Koch aus unserem Etablissement gesellt sich dazu und nach ein paar Schlücken eines vietnamesischen Extremalkohols wird die Runde lockerer. Zeichensprache hilft, ein Typ mit Baseballmütze führt Taschenspielertricks vor. Irgendwie biegen wir das Gespräch in Richtung Rauschhanf. „Marihuana, you know, for smoking“, sagt mein Freund, spitzt die Lippen und deutet tiefe Inhalationszüge an. Die Jungs lachen, was in Asien bekanntlich gar nix heisst. „Heroin?“, fragt einer und wir schütteln entgeistert den Kopf. „No, Marihuana!“, antworten wir. Einem der Männer geht ein Licht auf, „Ahh, Malihuana…“, ruft er und redet auf seine Freunde ein. Plötzlich grinsen alle wissend. „No have“, sagt der Eine, bietet sich aber an welches zu besorgen. Wir sind kurz unsicher, denn das geht ja fast zu glatt. Gleich am ersten Abend sollten wir auf die sprudelnde Quelle der lokalen Psychoköstlichkeiten gestoßen sein? Und was ist, wenn der Typ nicht mit Hanf, sondern Haftbefehl zurück kommt? Egal, wir sind heiß.
Ohne ein gewisses Vertrauen in die Menschen lebt es sich verkehrt und unsere Männer vom Strand wirken einfach sympathisch. Der freundliche Vietnamese dampft mit seinem Moped los, während wir fröhlich weiterquatschen. Geld wollte er nicht haben, er verspricht uns beste Ware für umgerechnet 15 Mark. Zwei Stunden später schlurfen wir zurück ins Hotel. Der Koch schließt hinter uns das Tor zu – von dem Gras keine Spur. Das ist uns mittlerweile auch egal, wir haben uns trotzdem mit den Jungs zum Fußball verabredet. Von riesigen Joints träumend reisst mich das Telefon auf dem Nachttisch aus dem Nickerchen. „Your Cigarettes are here“, sagt eine Stimme zu mir. Schlaftrunken stolpere ich ans Hoteltor, vor dem der Vietnamese mit seinen Freunden lächelnd steht. Etwas spät für einen gemeinsamen Joint vertrösten wir uns auf den nächsten Tag. Ich bedanke mich für die Aktion bei ihm und falle zurück in die Heia.

Das Tageslicht enthüllt das ganze Desaster: Das Kraut, welches sich in dem Beutel befindet, überhaupt mit dem wohlklingenden Namen „Marihuana“ zu beschönigen, wäre eine Beleidigung für jeden berauschenden Hanf in der Welt. Zwar handelt es sich um weibliche Blütenstände, diese hängen aber traurig und in ihrer Mickrigkeit völlig vertrocknet an dünnen Stengelchen. Der Haufen verblüfft durch einen dezenten Braunton, von Harz keine Spur. Die Geruchsprobe lässt auf eine unabsichtliche Fermentierung schließen. Aus den Hüllkapseln rieseln immerhin Samen. Um gar nicht erst in postkoloniale Pöbeleien zu verfallen machen wir die Probe aufs Exempel. Die mitgelieferten Blättchen sind so dick wie Zeitungspapier und natürlich ohne Klebefläche. Die daraus gebastelte Tüte gleicht einem männlichen Geschlechtsorgan nach drei Tagen Daueraufenthalt in der Badewanne. Der Geschmack ist ohne Charakter und erinnert schwer an „Deutsche Hecke“ Jahre vor 1994. Eine erheiternde Stimmung setzt nach dem Genuss des Joints ein, aber das hat definitiv nichts mit dem Gras zu tun. Wir amüsieren uns vielmehr über uns selbst und das Knistern der unzähligen Samen. Und komischerweise ist uns klar, dass wir hier nicht übers Ohr gehauen wurden, sondern das dies die normale vietnamesische Qualität darstellt.
Über den Genuss und die medizinische Anwendung von Marihuana in Vietnam ist wenig bekannt. Es wird aber vermutet, dass im Zuge der chinesischen Herrschaft über das Land auch der Hanf Einzug in die Kultur und die Medizin des Landes gehalten hat. Die chinesische Han-Dynastie eroberte schon rund 100 Jahre vor Christus weite Teile Asiens und auch das heutige Vietnam. Kaum ein Volk war so vielseitig in der Nutzung der Hanfpflanze wie die Chinesen: Hanf diente schon vor der Einverleibung Vietnams seit mindestens zwei Jahrtausenden (sic!) als Nahrung, zur Produktion von Seilen, Kleidung und Fischernetzen und zur Gesundung des Körpergeistes. Im heutigen Vietnam ist der Cannabis-Konsum unter Jugendlichen durchaus verbreitet. Ein Bericht im Auftrag der Europäischen Union spricht (eher anekdotisch) von „jungen Menschen, die in den öffentlichen Parks von Hanoi Cannabis rauchen und Mahjong spielen“. Das klingt doch nett! Der Report spricht weiter von „kleinen Läden“, in denen eine Zigarettenschachtel voll Cannabis für einen halben Dollar zu kaufen ist. Wir haben jedenfalls einen recht unkomplizierten und unglorifizierenden Umgang der Jugend mit Marihuana erlebt. Was nicht heißen, soll, dass die Polizei dem Treiben arglos zusieht. Wer mit Cannabis erwischt wird, sieht zumindest einer saftigen Geldstrafe entgegen, vom durchaus möglichen Aufenthalt im Gefängnis mal ganz abgesehen.
Glaubt man den spärlichen Informationen ist Vietnam in erster Linie Transit-Land für einen regen Verkehr mit Drogen aller Art. Im benachbarten Kambodscha wird Hanf in großer Menge angebaut – allein 1996 wurden weltweit 56 Tonnen Cannabis konfisziert, die aus Kambodscha stammten. Tatsächlich stammt das zweite Beutelchen Gras, welches wir erstehen, aus Kambodscha, aber dazu später mehr. Die Probleme mit Cannabis konsumierenden Jugendlichen werden von der vietnamesischen Regierung selbst als gering eingestuft. Kein Wunder, konzentriert man sich doch im „Kampf gegen die Drogen“ in erster Linie auf Opium und Heroin. Vietnam fungiert auch hier als Transitstrecke: Die lange Küste des Landes, das verwirrenden Mekong-Delta mit seinen rund 25 Tausend Fischerbooten und die grüne Grenze zu Kambodscha machen eine Kontrolle des Warenaustausches nahezu unmöglich. Über die seit 1991 offene Grenze zu China soll sich ebenfalls ein bunter Handel mit Produkten aller Art etabliert haben. Anfang der 90er Jahre kam zudem ans Licht, dass hohe Polizeibeamte und Militärs am Geschäft mit Heroin kräftig mitverdient hatten. Bis Ende der 80er Jahre hatte die Regierung (in guter sozialistische Tradition) bestritten, überhaupt drogennutzende Einwohner zu haben. Heute sieht das anders aus: 1996 sollen schon 240 Tausend Menschen heroinabhängig gewesen sein. Das Problem ist virulent: Über der Eingangstür zur örtlichen Diskothek hängt ein großes Schild mit dem Aufdruck „No Heroin please“ und in den Stadt stehen Schilder, die mit an die Volksgesundheit appellieren.

Nach dem dem Frühstück schwingen wir uns aufs Moped und fahren aus der Stadt heraus. Kurz darauf landen wir auf der N1, der Nationalstrasse des Landes. Hier fließt der gesamte Verkehr des Landes von Norden nach Süden und zurück. Alte sowjetische LKWs, Hühnertransporte, Busse, Mopeds, Fahrräder und Fußgänger teilen sich die schmale Straße. Armut herrscht abseits der Vorzeigestrassen der Stadt. Wellblechhütten, die Kinder spielen und leben fröhlich im Dreck. Ein zähes Volk tut sich auf, zum Teil noch körperlich durch den Krieg mit den USA und den Agent Orange-Einsatz gezeichnet. Verkrüppelte Beine, Arme, ein deformiertes Rückgrat bei einem vielleicht achtjährigen Kind, ein Kropf am Hals eines alten Mannes. Um den Irrsinn des Krieges zu ertragen, rauchten sich die US-Soldaten reichlich mit Marihuana dicht, kaum ein Amerikaner, der den Vietnam-Krieg ohne „Dope“ überstand. Der Heroinkonsum soll allerdings auch beträchtlich gewesen sein und hat amßgeblich zu seiner späteren Ausbreitung beigetragen. Offiziell starben zwischen 1964 und 1975 58.183 amerikanische Krieger. Süd-Vietnam hatte 223.748 Tote zu beklagen, für Nord-Vietnam wird die Zahl auf über eine Million geschätzt. 10 Prozent der Zivilbevölkerung (rund vier Millionen Menschen) starben, die meisten bei den Bombardements der US-Truppen im Norden des Landes.
Angesichts dieses, erst 25 Jahre zurückliegenden Krieges, verwundert es schon, dass die Jugend die westlichen Konsumgüter ohne Vorbehalte in ihre Lebenswelt integriert hat. Ob Nike-Baseballmützen und Turnschuhe, Levis-Jeans oder Fast-Food-Ketten. Fernseher und Touristenstrom bringen die heilsversprechende Nachricht von Coca Cola und MTV in das entfernteste Bergdorf. Und ob die sich gerne im Dreck wälzende Traveller-Kultur eine besseren Eindruck der westlichen Kulturerrungenschaften hinterlässt, wird selbst von den Einheimischen bestritten. Aber ob Traveller oder Tourist – jeder Reisende ist Medium dieser Nachricht und damit Teil eines Problems, welches mit den soziologischen Begriffen vom „gravierenden Wertewandel in traditionellen Gesellschaften“ nur unzureichend beschrieben ist.
Unsere Freunde vom Strand haben uns als verträgliche Menschen und wohl auch gute Einnahmequelle schätzen gelernt. Ein paar Tage später besorgen sie uns ein Beutelchen Gras, welches aus Kambodscha stammen soll. Um es kurz zu machen: Auch dieses Killergras lässt uns höchstens müde werden, die Wirkung von Tabak und Marihuana sind nicht eindeutig aus einander zu halten. Zwar sieht es etwas besser aus als die erste Ladung, Geruch und Geschmack sind aber wieder vollkommen indifferent. Aber irgendwie bringt es trotzdem Spaß kiffend auf dem Balkon zu sitzen und durch Palmen aufs südchinesische Meer zu schauen. Im Urlaub in fernen Ländern ist das Bewusstsein eh schon so sensibilisiert und von taufrischen Eindrücken umschmeichelt, dass schon der Qualm einer Sportzigarette den letzten Schubser ins Reich der Wohlfühligkeit gibt.

Kurz vor Ende unseres Aufenthalts in der Stadt finden wir eher zufällig heraus, aus welcher Quelle die Beutelchen mit dem Gras stammten. Ich will der Information kaum trauen, versuche es aber trotzdem: Am Straßenrand steht einer kleiner Stand auf Rädern, Zigaretten und Tabak werden verkauft. Hinter dem Wägelchen liegt eine Oma und schläft. Ich warte bis sie die Augen aufschlägt, dann frage ich nach Marihuana. Sie lacht, greift unter ihren Stand und zieht eine Plastiktüte hervor. In dieser warten viele Beutelchen auf Kundschaft. Nachdem ich ihr das Geld überreicht habe, legt sie sich wieder schlafen.