Lass das doch die Community machen
Mit Web 2.0 spielt das Kollektiv wieder eine größere Rolle im Internet. Gleich mehrere Branchen wittern das große Geschäft
Kaum jemand kann momentan das Schlagwort vom „Web 2.0“ ignorieren. Vor einigen Wochen tummelten sich die Zweinuller-Protagonisten beim „Next 10 Years“-Kongress ( Nach der Party ist vor dem Boom – oder doch dem Kater? (1)), jetzt trafen sich Kommunikationsexperten zum Hamburger Dialog (2) im Kongresszentrum der Stadt. Auch hier waren die Erwartungen an die „Neuerfindung des Internet“ groß.
Blogger, Bookmarker, Filmtauscher und Fotot-Communities: Es scheint, als würden plötzlich alle Besitzer eines Modems als Ultra-Kreative wiedergeboren. Die Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Alleine 250.000 Blogs in Deutschland, in Frankreich über 3,5 Millionen dieser Tagebücher. Die Blogger-Suchmaschine Technorati (3) scannt aktuell über 42 Millionen Blogs weltweit, Tendenz weiter steigend. Wie viele davon regelmäßig gepflegt werden, ist unklar. Fest steht: Blogger sind jung, die Hälfte aller Schreiber ist zwischen 13 und 27 Jahren alt. Bekannt geworden durch Krisenjournalismus wird Bloggen heute zum alltäglichen Kommunikationsmittel, wobei die Selbstreferentalität riesig ist. Blogger verweisen gerne auf andere Blogger.
Versorgung einer fragmentierten Verkaufslandschaft
Nun entdecken die Unternehmen die Weblogs und Communities. Es geht um Imageförderung, um Unternehmenskultur und um Maßnahmen der Kundenbindung. Beim Computer- und Softwarehersteller Sun Microsystems bloggen 3.000 der 32.000 Mitarbeiter öffentlich einsehbar. Wichtige Interna bleiben natürlich außen vor. Wer diese ausplaudert, so wie Mark Jen (4), wird entlassen. Der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter hatte bei Google angeheuert und in deren Blog fröhlich auf seinen neuen Arbeitgeber gemotzt.
Das dürfte Charles Fränkl nicht so schnell passieren. Seit kurzem bloggt (5) der CEO von AOL-Deutschland über das Wetter in Hamburg. Die Firma Frosta hat einen Unternehmensblog (6), in dem Mitarbeiter über die Ereignisse der Firma berichten sollen. Aber nach anfänglicher Euphorie scheint das Projekt einzuschlafen. Eine Gefahr, die in anderen Bereichen der Web 2.0-Sphäre mit dem Wort „Konsolidierung“ bezeichnet wird.
Am liebsten ist es aber den Unternehmen, wenn ihre Marke mit der Vertrauenswürdigkeit almagiert, die firmenexternen Bloggern zugeschrieben wird. Bei Vespaway (7) treffen sich Vespa-Fans und beglückwünschen sich zu ihrem Hobby. Traum aller Firmen ist es ein aktives Blog an die eigene Website zu binden. Derweil steigt die Popularität einiger Blogger. Opel engagierte jüngst vier solcher „A-Blogger“, um über ihre Erlebnisse mit einem zur Verfügung gestellten Astra zu berichten (8). AMD sucht nun Notebook-Blogger (9). Die Grenze zwischen klassischem Journalismus und Blog-Presse verwischen.
Es gibt viele Beispiele, ob daraus allerdings eine Schule wird, die sich nachhaltig ökonomisch nutzen lässt, ist noch offen. Unter den Top-Ten der deutschen Blogs befinden sich Perlen, die weit unter 1.000 Leser täglich haben. Ketzerisch wurde auf dem „Hamburger Dialog“ gefragt, ob eine Flugblattaktion in der Innenstadt nicht mehr Reichweite hätte.
Social Commerce
Weiter Hoffnungshorizonte zeigen sich: Statt großer E-Commerce-Portale sollen kleine Internetseiten für eine fragmentierte Verkaufslandschaft sorgen. Eines der Beispiele, das dies funktionieren kann, ist die Firma „Spreadshirt“. Jeder kann einen eigenen Shop eröffnen und wird dafür an den Verkaufserlösen von bedruckten T-Shirts beteiligt. Heute soll es bereits 150.000 Shop-Partner geben, Umsätze in der Region von 10 Millionen werden akklamiert. Das Schlagwort hierfür: „Social Commerce“, es soll den Übergang vom Massenmarkt zum Nischenmarkt beschreiben.
Was daran neu ist? Vielleicht wenig, viele haben klein angefangen, wurden groß und drängen nun kleinere Firmen aus dem Wettbewerb. Bis jetzt spricht wenig dafür, dass T-Shirt-Versender die anhaltende Konzentration der Wirtschaftskraft auf multinationale Konzerne aufhalten. Auch in Zeiten von Web 2.0 erwirtschaften unter ein Prozent der Unternehmen 75 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts. Es dürfte interessant sein zu beobachten, welche Konzentrationsprozesse sich im Rahmen der Blogger- und Community-Sphäre zwangsläufig ergeben werden.
Ohne Konkurrenz in Deutschland ist Open BC:www.openbc.com/ (10), eine kostenpflichtige Kontaktbörse für Geschäftsfreaks. Was zunächst aussah wie ein Treffpunkt für ehemalige Klassenkameraden, entwickelte sich zu einer ernsthaften Geschäftanbahnungsplattform. Der Club rechnet dieses Jahr mit einem Umsatz von mindestens 10 Millionen Euro. Über das Knüpfen von Geschäftskontakten hinaus berichtet inzwischen fast jeder Sechste von Geschäftsabschlüssen mit Open BC-Kontaktpartnern. Der Gründer Lars Hinrich hält in trockener Manier die Bälle trotzdem gerne flach. Auch er spricht von einer „Konsolidierung der Web 2.0-Branche in den nächsten zwei bis drei Jahren“.
Das Aal-Prinzip
Männer wie Andreas Weigand, früher Manager bei Amazon, hoffen gleichwohl weiter. Er prophezeite auf dem Web 2.0-Kongress eine noch stärkere Fragmentierung, „und zwar auf Angebots- wie auf Nachfrageseite“. Der entscheidende Satz, der die Geisteshaltung hinter der ökonomisch forcierten Web 2.0-Aufregung offenlegte, fiel kurz darauf. „Ich vertraue auf das ‚Aal-Prinzip'“, erklärte Weigand dem staunenden Publikum: „Andere arbeiten lassen.“
Aus dieser Sicht ist die Community nur eine Zielgruppe, deren soziale Kohäsion und geistiges Potential ausgenutzt werden soll. Warum, so die rhetorische Frage, sollen wir uns die Finger wund und Kassen leer werben? Zudem an eine Generation, die zunehmend werberesistent ist? Eine Generation, die eventuell immer weniger bereit dazu ist, den Versprechen der glatten Hochglanz-Körper zu glauben? Eine Generation, die selbst hinter anarchisch aufgemachten Spots die Kinderarbeit in Pakistan ausmacht?
Nur daher, so der Verdacht, sind die Vorstandsetagen zur Zeit so sehr vom Begriff der „Communities“ erregt. Deren eigentlicher Zweck, nämlich der Austausch von Wissen und die gemeinsame Identität, wird zur neuen Variable in der Kundenansprache. Und so kommt es, wie so oft im Internet: Eine soziale Idee wird monetär umgemünzt und verliert nicht nur den Charme, sondern eventuell auch ihr Gewicht.
Mix it!
Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Internet mit Web 2.0 tatsächlich eine grundlegende Veränderung ins Haus steht. Private Web-Applikationen greifen auf professionelle Datenbanken zu, die Grenzen zwischen Web- und heimischer PC-Anwendung zerfließen, es wird gemixt und gemasht, plötzlich kann hier jeder mit jedem. Blogs sind nicht nur Tagebücher in HTML, sondern an komplexe Datenbanken und Webservices angeschlossen. Durch Tagging und Trackbacklinks verteilen sich Modifikationen am Blog blitzschnell und auch weit. „Suchmaschinen lieben Blogs“, sagt denn auch Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google Deutschland.
Die zugrunde liegende Technik ist für viele Blogger ein Rätsel. Wo früher Nerds im Code wuselten, mit einem Editor HTML-Dateien schrieben, über ftp auf einen Server schoben und wenn es ganz schlecht lief auch noch über Telnet und chmod-Befehle Zugriffsrechte regeln mussten, kann heute Jedermann mit grundlegenden Tastaturbedienungsfertigkeiten seine Ideen grafisch proper aufbereitet ins Web stellen. Das ist einerseits ein unbedingtes Mehr an Beteiligung. Auf der anderen Seite geben damit immer mehr User ihre technische Kompetenz an Software-Hersteller ab. Nur gut, wenn Codes der GPL (11) unterliegen.
Firmen wie Amazon haben den Trend zu Web 2.0 schon früh erkannt und ihre Schnittstellen für Webuser offen gelegt. Seither zeigen sich immer mehr Firmen bereit, den Kunden als Kompagnon anzusehen. Aber während Bloggen einfach ist, gestaltet sich die Anbindung über APIs (Application Programming Interfaces) technisch anspruchsvoll. Auch das mit Web 2.0 eng zusammenhängende AJAX ist kaum ein Feierabend-Hobby und verpflichtet beiden Seiten zum Einsatz neuester Technologien und Clients. Von der mangelnden Barrierefreiheit mal ganz zu schweigen.
Web 2.0-Blase?
Seit 2000 weiß man, es ist Vorsicht vor allzu euphorischen Erwartungen geboten, vor allem dann, wenn der Satz fällt: „In Amerika sind sie da schon viel weiter.“ Dies wurde vor dem Platzen der Internetblase ebenfalls wie ein Mantra wiederholt mit den bekannten Folgen.
Gleichwohl hört man den Verweis auf die USA in den letzten Monaten häufig, nicht zuletzt, weil einige der Großkopferten auf Einkaufstour gingen. Yahoo erwarb zunächst für 20 Millionen Dollar den Bildersammeldienst Flickr (12), später für 30 Millionen Dollar die Online-Bookmarksammlung Del.icio.us (13). Beides mal wieder Portale, die aus purer User-Lust an Gemeinsamkeit entstanden waren. Um den Zug nicht zu verpassen sackte Rupert Murdoch für satte 500 Millionen Dollar MySpace (14) ein. 72 Millionen User, davon ein Fünftel unter 18 Jahre alt, wissen seither nicht so Recht, ob sie sich gut behütet oder vereinnahmt fühlen sollen.
Aber im Gegensatz zum Zusammenbruch im Jahre 2000 soll dieses Mal alles anders sein. Denn, so die Auguren, dieses Mal wird Funktion und nicht Hoffnung verkauft. Tatsächlich ist man schlauer geworden, heute zählen Unternehmensgewinne mehr als windige Geschäftsmodelle. Und eine große und möglichst aktive Community soll Unternehmen helfen, Geld in die Kassen zu spülen. Ausgangspunkt aller Konzepte ist ein verändertes Medienverhalten gerader jüngerer Menschen. Diese kaufen sich nicht einmal mehr eine Lokal- oder Tageszeitung, um die U-Bahnfahrt zu überstehen, sondern informieren sich lieber zu Hause oder sonstwo: und zwar im Internet.
Medien-Imperien
Das Kerngeschäft der Medienunternehmen stagniert. Mit Grauen beobachten Zeitungsverleger das Absinken ihrer Auflage. Und Bücher und DVDs als Abkopplung seien, wie es auf dem Hamburger Dialog formuliert wurde, „als Thema ziemlich ausgelutscht“.
Die Macher von „Bravo“, „Bym“ und „Mädchen“ überlegen fieberhaft, wie die mobile Generation zu fassen ist. Die Lösung: Der Nutzwert der Inhalte im Internet muss den Grundstein für redaktionelle und anzeigengetriebene Erlösmodelle legen. Da passt es, dass die Selbstdarstellungsgesellschaft aufgrund einfacher technischer Tools neu im Netz angekommen. Die Blogs sind sicheres Zeichen einer Emanzipation der User, der nicht mehr nur passiver Rezipient, sondern auch Produzent sein will. Verlage, Unternehmer, Konzerne: Alle träumen von einer Community, deren Mitglieder ihre Homepage mit sprudelnden Ideen flutet. Sanfte Kritik würde sogar akzeptiert werden, auch sie ist dann natürlich Teil der „offenen Unternehmenskultur“. Egal, solange Blogs und Foren die emotionale Nähe verstärken. Dem Schnapshersteller Jägermeister beispielsweise ist das gelungen. Aktuell sollen in der Jägermeister-Community 50.000 User registriert sein.
Teile der Branche gehen von einer völligen Ablösung des klassischen Sender-Empfänger-Modells aus. Gemischt mit dem Umstand, dass sich viele Menschen die komplexe Welt am liebsten von Freunden und Bekannten erklären lassen, werden einige der Online-Communities zu den neuen „Gelben Seiten“ erkoren. Auf diesen Hype setzt auch Qype (15). Hier können registrierte Nutzer lokale Tipps geben und nehmen. Restaurants, Werkstätten, Friseure: Erna aus Wuppertal empfiehlt ihren Frauenarzt, Dieter aus Wanne-Eickel seinen Klempner. Stephan Uhrenbacher, Gründer von Qype, behauptet: „Die Ära der Massenmedien wird von der Ära der persönlichen und partizipativen Medien abgelöst.“
Bei Burda, Springer, Holtzbrinck und Bertelsmann hat man die soziologischen Studien zum veränderten Gesellschaftsbild gelesen und will nun reagieren. Denn Gruppen definieren sich heute weniger als früher über ihre soziale Herkunft, sondern mehr über gemeinsame Interessen. Für Medien- und Werbemacher sind daher die Daten der bislang primär soziodemographischen erfassten Zielgruppen weniger relevant. Kunden können heute durch ihr hinterlegtes Nutzerprofil viel direkter angesprochen werden. Die auf Homepages werbenden Unternehmen kommen so dicht wie nie an ihre Zielgruppe heran, das One-to-One-Marketing ist keine Fiktion mehr. Und der Konsument macht sich freiwillig gläsern.
Der „Heavy-Web-User“, so Sven Dörrenbächer von Mercedes, sei mit klassischer Werbung schwer zu erreichen. Der Autohersteller versuche daher sich dem „digitalen Lifestyle“ seiner zukünftigen Kunden anzupassen. Sein Credo im Kongresszentrum in Hamburg: „Keiner braucht Werbung, jeder braucht Identifikation.“ Mit anderen Worten: Im Rahmen gegenseitiger Annäherungen verpasst der Konzern den Community-Mitglieder über Mixed-Tapes (16) die erste homöopathische Dosis Mercedes. Sie sollen, so Dörrenbächer, zu „brand advocates“ werden.
So sind Communities kein direktes Geschäftsmodell, sondern Maßnahmen der Vertrauens- und Aufmerksamkeitsförderung. Der Erfolg ist dabei von Markenbekanntheit und dem Mehrwert für das Community-Mitglied abhängig. Für Unilever flirtete der „Darf-Coach“, Bayer rief zu „Rettet-die-Liebe“ auf. Und Burda hat sich den Begriff der „Media Communities“ bereits schützen lassen. 2005 wuchs der Umsatz des Unternehmens im Internet um über 36 Prozent auf 174,3 Millionen Euro. Daran soll angeknüpft werden. Die Zeitschrift Bunte startet in Kooperation mit T-Online die Aktion Starshots (17). Jeder kann hier Videos und Fotos veröffentlichen.
Hinter den Mühen steht die schlichte Erkenntnis: „Auf eine Erholung des Kerngeschäfts deutet nichts hin.“ So formulierte es Manfred Schwaiger, der an der Universität München lehrt und eine Studie über Wachstumsfelder für Verlage durchgeführt hat. Die Anzeigenerlöse deutscher Printmedien sanken zwischen 2000 und 2005 um 20%. Die Finanzierung der Online-Auftritte durch Bezahlmodelle funktioniert selten, für Online-Artikel will kaum ein Zeitungskunde zahlen. Der andere und gängige Weg ist daher, Erlöse aus kontextueller Werbung zu beziehen.
Hier sind aber die Internet-Multis wie Google, Microsoft und Yahoo erheblich weiter. Immer mehr Firmen legen ihren Werbeetat lieber Online an. Werbeschaltungen bei den Suchmaschinen sind für beide Seiten lukrativ, für eine Firma ist die Abrechnung transparent, sie kann genau feststellen, welcher Klick über Google tatsächlich zum Kauf eines Produkts geführt hat. Von diesem Spiel wollen sich die deutschen Verlage mit eigenen Vermarktungsmodellen unabhängig machen.
Werbung für Werbung
Die an die Medienunternehmen angehängte Werbebranche will ebenfalls Morgenluft schnuppern. Mit stiller Bewunderung beobachtete man Jahre lang das Verbreiten von Chaos-, Nonsense- und Werbefilmen über Email. Beliebtes Beispiel ist hier Oliver Pocher, dessen Genöle im Media-Markt-Spot über sechs Millionen Mal im Download-Fenster landeten. Wie kann man einen solchen Erfolg vorhersagen? Antwort: durch geistige Krankheitserreger. Die alte Mund-zu-Mund-Propaganda hat es in den virtuellen Raum geschafft und wird nun „virales Marketing“ genannt. Aus den sich über Mail, Foren und Communities virenartig-unberechenbar verbreitenden Schnipsel sollen nun sorgsam geplante Kampagnen werden.
Robert Krause von der Agentur „This Gun is For Hire“ stöhnte auf dem Hamburger Dialog denn auch: „Jetzt sollen sich zwei Millionen Kunden über Haargel unterhalten.“ Auch seine Branche folge alle paar Jahre einem neuen Hype: „Tribal-Marketing“, „Guerilla-Marketing“ „virales Marketing“. Schöne Begriffe, oft war unklar, ob beim Konsumenten etwas von der Aktion hängen blieb. Für Krause ist evident: „Die Idee muss stimmen, dann kann virales Marketing hintendran gehängt werden.“ Ob das dann klappt, sei aber nie sicher, denn „letztlich bleibt es eine Markenaktion“.
Der Erfolg der Communities hängt eng mit ihrer Authentizität zusammen – und die wurde bislang meist deshalb empfunden, weil Marketinginteressen keine Rolle spielten. Der Energieversorger E.ON muss das erfahren. Er baute schon 2002 eine Online-Gemeinschaft auf, die zwei Jahre später wieder geschlossen wurde. Das Interesse an der schlichten Nachricht „Ich-bin-on“ war zu gering geworden.
Links
(1) http://www.telepolis.de/r4/artikel/22/22661/1.html
(2) http://www.hamburger-dialog.de/
(3) http://technorati.com/
(4)
(5) http://www.charles-blog.com
(6) http://www.blog-frosta.de/
(7) http://www.vespaway.com/
(8)
(9) http://amd-notebooks.de/blog/
(10) http://Open BC:www.openbc.com/
(11) http://www.gnu.de/gpl-ger.html
(12) http://www.flickr.com/
(13) http://del.icio.us/
(14) http://www.myspace.com/
(15) http://qype.com/
(16) http://www3.mercedes-benz.com/mixedtape/mixedtape.html
(17) http://www.bunte-starshots.de/

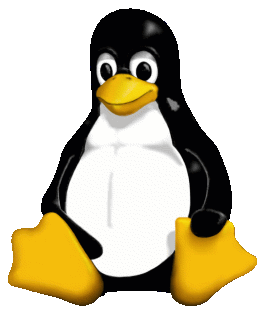








 Ein Beispiel: So erstritten ein Hersteller einer Margarine die Eintragung der Wortmarke „Du darfst“ ins Markenregister und eine Firma für Haushaltsgeräte den Begriff „Zisch & Frisch“. Die Richter waren der Meinung, dass „Du darfst“ eine unvollständige Aufforderung darstellte, deren gedankliche Ergänzung durch den Kunden den Kriterien des „phantasievollen Überschusses“ entsprach. Im Urteil zu den Küchenmaschinen machte die Lautmalerei des „Zisch“ in Zusammenhang mit dem „Frisch“ bei den Richtern Eindruck. Im selben Jahr (1997) hatten der 26. Senat des hohen Gerichts allerdings den Slogan „IS EGAL“ abgeschmettert. Da fragte sich der abgewiesene Getränkeabfüller, wenn „Du darfst“, warum „IS“ das dann nicht „EGAL“?
Ein Beispiel: So erstritten ein Hersteller einer Margarine die Eintragung der Wortmarke „Du darfst“ ins Markenregister und eine Firma für Haushaltsgeräte den Begriff „Zisch & Frisch“. Die Richter waren der Meinung, dass „Du darfst“ eine unvollständige Aufforderung darstellte, deren gedankliche Ergänzung durch den Kunden den Kriterien des „phantasievollen Überschusses“ entsprach. Im Urteil zu den Küchenmaschinen machte die Lautmalerei des „Zisch“ in Zusammenhang mit dem „Frisch“ bei den Richtern Eindruck. Im selben Jahr (1997) hatten der 26. Senat des hohen Gerichts allerdings den Slogan „IS EGAL“ abgeschmettert. Da fragte sich der abgewiesene Getränkeabfüller, wenn „Du darfst“, warum „IS“ das dann nicht „EGAL“?