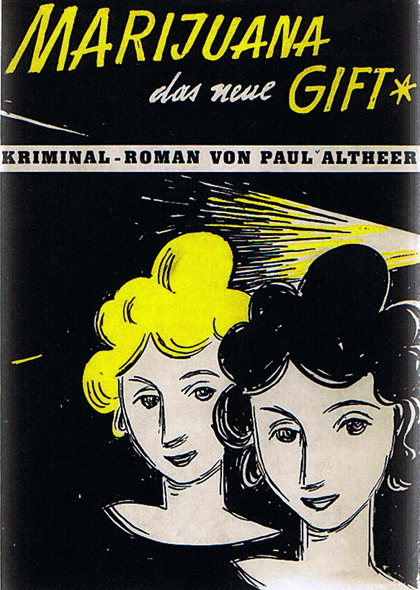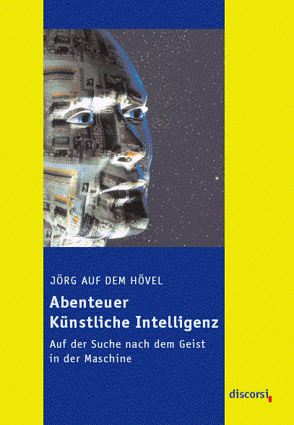hanfblatt, 2003
Zwei Schritte vor, einer zurück
Interview mit Dr. med. Franjo Grotenhermen
Dr. med. Franjo Grotenhermen ist Mitarbeiter des nova-Instituts für ökologische Innovation in Hürth (Rheinland) und Vorsitzender der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (IACM) mit Sitz in Köln. Er führt zudem die Geschäftsführung der deutschen Sektion, der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM). Grotenhermen ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, darunter den Standardwerken „Cannabis und Cannabinoide: Pharmakologie, Toxikologie und therapeutisches Potenzial“ (Huber-Verlag) und „Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt (Springer-Verlag).

Hanfblatt: Jahrtausendelang wurde Hanf weltweit in traditionellen Kontexten medizinisch genutzt. Im 19. Jahrhundert wurde schließlich auch in Europa mit alkoholischen Extrakten aus getrockneten Hanfblüten experimentiert, wurden zahlreiche Indikationen postuliert und überprüft. Doch es gelang nicht, einen eindeutigen Wirkstoff zu isolieren und zuverlässig wirksame standardisierte Extrakte zu entwickeln. Auch empfand man die psychoaktive Wirkung bei vielen Anwendungen als störend. Man konzentrierte sich von Seiten der Pharmaindustrie auf andere Pharmazeutika, bevorzugt synthetische oder teilsynthetische Reinsubstanzen. Cannabis indica galt schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als medizinisch obsolet. Die weltweite Verteufelung des Konsums von Hanf als psychoaktives Genussmittel durch die in den Zwanziger Jahren beginnende Prohibitionspolitik und die ab den Dreissiger Jahren ausgehend von den USA inszenierte Anti-Marihuana-Hysterie schien der Erforschung medizinischer Nutzungsmöglichkeiten den Gnadenstoß zu versetzen. Wann genau begann nun das Interesse hieran wieder aufzuflammen, und wie erklärt sich dieses Phänomen?
Grotenhermen: Die fehlende Standardisierung medizinischer Cannabiszubereitungen war tatsächlich einer der wesentlichen Gründe, möglicherweise der wichtigste Grund für das Verschwinden dieser Medikamente aus den Apotheken Europas und Nordamerikas. Erst Mitte der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts gelang es einer israelischen Arbeitsgruppe die genaue Struktur des Delta-9-Tetrahydrocannbinol (kurz: Delta-9-THC oder THC) zu entschlüsseln. Dies war ein wichtiger Impuls für die moderne Cannabinoid-Forschung. Neben diesem laborchemischen Grund für eine starke Zunahme der Forschungsvorhaben zu Beginn der siebziger Jahre förderte die Zunahme des Cannabiskonsums unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen der westlichen Industriestaaten auch das wissenschaftliche Interesse an den Wirkungen der Droge und ihrer Inhaltsstoffe auf den Menschen. Mitte der siebziger Jahre gab es die ersten klinischen Studien mit THC, in denen man mögliche therapeutische Wirkungen untersuchte, wie seine Wirksamkeit bei Erbrechen und Übelkeit im Rahmen einer Krebschemotherapie, den appetitanregenden Effekt oder die Senkung des Augeninnendrucks beim Glaukom (grüner Star).Dieser ersten Welle der modernen Cannabisforschung folgte etwa zwanzig Jahre später die zweite, noch größere Welle, die erneut durch eine grundlegende Entdeckung ausgelöst worden war. Ende der achtziger Jahre und Anfang der neunziger Jahre wurde das körpereigene Cannabinoidsystem entdeckt, das aus spezifischen Bindungsstellen für Cannabinoide und körpereigenen Bindungsstoffen besteht. Die spezifischen Bindungsstellen heißen Cannabinoid-Rezeptoren und die körpereigenenen Bindungsstoffe heißen endogene Cannabinoide oder Endocannabinoide, von denen Anandamid, 2-Arachidonylglyzerol und Noladinäther die drei wichtigsten sind. Dieses körpereigene Cannabinoidsystem, das wurde bald klar, spielt eine Rolle bei vielen Körperprozessen, wie etwa bei der Verarbeitung von Sinneseindrücken, bei der Verarbeitung von Schmerzen, bei der Regulierung des Appetits. Das Verständnis der natürlichen Funktionen des Cannabinoidsystems beinhaltet das Verständnis der Wirkmechanismen bei therapeutisch gewünschten Wirkungen, wie etwa der Schmerzlinderung, und bei möglicherweise unerwünschten Wirkungen, wie etwa der Störung des Gedächtnisses.
Hanfblatt: Welche medizinischen Indikationen haben sich in den letzen Jahren für die Anwendung von Cannabis und Cannabinoiden als erfolgversprechend erwiesen?
Grotenhermen: Am besten erforscht sind die therapeutischen Cannabis- bzw. THC-Wirkungen bei Übelkeit und Erbrechen, wie sie bei der Krebschemotherapie auftreten können, sowie bei Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust im Zusammenhang mit der Aids-Erkrankung. Als am wichtigsten scheinen sich jedoch heute die Behandlung chronischer Schmerzen unterschiedlichster Ursache und der Einsatz bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen, wie etwa multiple Sklerose und Querschnittserkrankungen nach Verletzung der Wirbelsäule, herauszukristallisieren. Bei einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin in Zusammenarbeit mit dem Institut für onkologische und immunologische Forschung in Berlin aus dem Jahre 2001 zur medizinischen Verwendung von Dronabinol (THC) und natürlichen Cannabisprodukten (Marihuana, Cannabistinktur, Haschisch) nahmen etwa ein Viertel der teilnehmenden Patienten diese Substanzen wegen chronischer Schmerzen, wie Migräne, Phantomschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Arthritis, Colitis ulzerosa, Fibromyalgie etc, ein weiteres Viertel wegen neurologischer Symptome. Die verbleibende Hälfte verteilte sich auf eine Vielzahl weiterer Erkrankungen wie Aids, Krebs, Hepatitis C, Juckreiz, Asthma, Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, Alkoholismus, Opiatabhängigkeit, Glaukom, Epilepsie, etc. Cannabisprodukte werden also bei vielen Krankheiten und Symptomen erfolgreich verwendet. Man muss aber wissen, dass sie nicht immer das Mittel der ersten Wahl darstellen. So wird man beispielsweise bei Asthma, Glaukom und vielen anderen Erkrankungen zunächst andere Medikamente versuchen oder zunächst nicht-medikamentöse Verfahren ausprobieren, im Falle von Schlafstörungen zum Beispiel Entspannsungsübungen. Zudem wirken Cannabisprodukte nicht immer oder nicht immer im gewünschten Umfang. Viele Indikationen sind kaum erforscht, so dass sich nicht sagen lässt, wie hoch der Prozentsatz der Patienten mit einer der oben genannten Erkrankungen ist, der von einer Behandlung profitieren würde. Ich kenne aber Patienten aus allen oben genannten Indikationsbereichen, die von einer Behandlung mit Cannabisprodukten profitieren.
Hanfblatt: Wo liegen gegenwärtig die Forschungsschwerpunkte?
Grotenhermen: Die Themen der Cannabinoid- und Cannabisforschung sind heute breit gestreut. Während Mitte der achtziger Jahre in der medizinischen Datenbank Medline jährlich etwa 250 neue Artikel mit aktuellen Forschungsergebnissen zu den Bereichen Cannabinoide, Cannabis und Marihuana aufgeführt wurden, waren es im vergangenen Jahr etwa 800 mit weiter steigender Tendenz. Man kann vielleicht folgende wichtige Bereiche ausmachen: (1) Grundlagenforschung zum besseren Verständnis der Bedeutung und Funktionsweise des menschlichen Cannabinoidsystems, (2) Forschung zur besseren Abschätzung möglicher schädlicher Langzeitwirkungen und anderer Wirkungen des Cannabiskonsums, (3) Forschung zur Überprüfung der Wirksamkeit von Cannabinoiden bei verschiedenen Erkrankungen und zur Entwicklung neuer Medikamente, die das Cannabinoidsystem beeinflussen. Solche neuen Medikamente können wie das THC, die Cannabinoid-Rezeptoren stimulieren, eventuell aber auch die Konzentration der Endocannabinoide beeinflussen oder die Cannabinoid-Rezeptoren blockieren. Hier werden heute viele Ansätze erprobt, und ich gehe davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren eine Anzahl von Medikamenten auf den Markt kommen wird, die auf unterschiedliche Art und Weise das Cannabinoidsystem modulieren.
Hanfblatt: Was muss noch geschehen, damit jeder Mensch, dem Cannabis, bei der Heilung seiner Krankheit oder bei der Linderung von Beschwerden helfen könnte, auch problemlos Zugang zum richtigen Medikament erhalten kann?
Grotenhermen: Das Thema ist stark ideologisiert, in dem Sinne, dass Prinzipien oft über Vernunft und gesunden Menschenverstand gesetzt werden. Eines dieser Prinzipien, das zunächst einmal sehr vernünftig ist, lautet: In Deutschland dürfen nur qualitätsgeprüfte Medikamente verwendet werden. Dabei scheut man sich jedoch vor der Beantwortung der Frage, ob denn umgekehrt ein Schwerkranker, der keinen Zugang zu einem qualitätsgeprüften Medikament auf Cannabisbasis hat, beispielsweise weil die Krankenkasse die Finanzierung einer Behandlung mit Dronabinol (THC) ablehnt, und der sich Hanfpflanzen auf seinem Balkon zieht, vor ein Gericht gestellt und eventuell ins Gefängnis gesteckt werden sollte. Möglicherweise werden erst die Gerichte der Politik klar machen müssen, dass die Gesetzgebung in diesem Bereich überholungsbedürftig ist. Es gibt hier erste Anzeichen. Die Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen die öffentliche Diskussion schon länger geführt wird als hierzulande, wie beispielsweise in Kanada und Großbritannien, zeigen, dass solche Entwicklungen viele Jaher dauern. Einen Zugang zur direkten medizinischen Verwendung von Cannabisprodukten im Sinne einer tolerierten oder wie auch immer erlaubten Selbstmedikation wird es vermutlich nur geben, wenn aus politischer oder höchstrichterlicher Sicht die Verfügbarkeit von Cannabisprodukten aus den Apotheken nicht zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung führt. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn die Krankenkassen sich auch in Zukunft in vielen Fällen weigern, die Kosten zu erstatten und die Medikamente weiterhin im Vergleich zu illegalem Cannabis sehr teuer sind.
Hanfblatt: Wer sollte auf keinen Fall Cannabisprodukte zu sich nehmen, weder als Medikament, noch zu Genusszwecken? Was sind sozusagen die Kontraindikationen?
Grotenhermen: Ganz allgemein kann man sagen, dass jemand der Cannabis nicht verträgt, es auch nicht nehmen sollte. Das ist eine einfache Regel, die aber oft nicht befolgt wird. So werde ich gelegentlich von Cannabiskonsumenten kontaktiert, die mir berichten, dass sie seit einiger Zeit unangenehme psychische Erlebnisse, wie etwa Angstzustände, beim Konsum erleben, jedoch weiterhin konsumieren möchten. Der Abschied von der Droge fällt oft auch bei schlechter Verträglichkeit nicht leicht. Darüber hinaus gibt es einige Personengruppen, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ihnen der Konsum schaden kann. Dazu zählen Personen, die an einer schizophrenen Psychose leiden, weil der Krankheitsverlauf ungünstig beeinflusst werden kann. Auch bei anderen schweren psychiatrischen Störungen ist die Wahrscheinlichkeit einer schlechten Verträglichkeit bzw. eines gesundheitlichen Schadens größer als bei psychisch Gesunden. Eine Schwangerschaft stellt eine relative Kontraindiaktion dar. Zwar sind die Schäden für den Embryo bzw. Fetus vermutlich auch bei starkem Konsum im Vergleich mit anderen Drogen gering, aber man sollte den Fetus nicht unnötig fremden Substanzen, die über den mütterlichen Kreislauf in seinen Kreislauf gelangen, aussetzen. Wer an Schwangerschaftserbrechen leidet oder anderen schwangerschaftsbedingten Beschwerden, die durch Cannabis gelindert werden können, dem würde ich allerdings durchaus zuraten, es einmal mit Hanf zu versuchen, und wenn er wirkt, ihn auch zu verwenden.
Hanfblatt: Was kann man aus medizinischer Sicht denjenigen empfehlen, die Cannabis als Genussmittel konsumieren, um eventuelle Risiken möglichst gering zu halten?
Grotenhermen: Beim Cannabiskonsum gibt es zwei Hauptthemen, wenn von möglichen Schäden die Rede ist. Das eine sind mögliche Schäden durch das Rauchen, die vermutlich weitgehend denen des Tabakrauchens ähneln, da beide Pflanzen und auch ihr Rauch bis auf das Nikotin und die Cannabinoide weitgehend ähnlich zusammengesetzt sind. Durch das Verbrennen von getrocknetem Pflanzenmaterial entsteht eine Anzahl von Substanzen, die die Schleimhäute schädigen und krebserregend wirken können, wie zum Biespiel Benzpyren oder Nitrosamine. Die Empfehlung lautet also: Weniger rauchen. Dies kann beispielsweise durch oralen Konsum (Kekse, Tee) oder durch das Rauchen THC-reicher Sorten erzielt werden. Das zweite Thema bezieht sich auf mögliche psychische und soziale Folgen des Konsums. Es besteht die Gefahr, dass mögliche positive Auswirkungen des Cannabiskonsums auf das seelische Befinden und das soziale Leben sich in ihr Gegenteil verkehren. Wie beim Umgang mit anderen potenziell suchtauslösenden, schönen und Freude bereitenden Aktivitäten sollte man darauf achten, dass man mit diesen Aktivitäten gestaltend und schöpferisch umgeht, dass man also nicht mit der Zeit psychisch von dieser Aktivität abhängig und sozial gelähmt wird. Man sollte als Konsument in dieser Frage selbstkritisch sein. Dabei kann bei gewohnheitsmäßigem Konsum von Drogen auch eine gelegentliche Konsumpause von einigen Wochen sinnvoll sein. Nach meiner Auffassung ist die Diskussion um die Frage, ob Cannabiskonsum körperlich abhängig machen kann oder nicht, eine wenig hilfreiche Diskussion, da auch eine psychische Abhängigkeit sehr stark sein kann und es letztlich unwichtig ist, ob vermehrtes Schwitzen und Schlafstörungen, die beim Absetzen auftreten können, psychische oder körperliche Symptome darstellen. Nach meinen Erfahrungen, die sich mit der wissenschaftlichen Erkenntnis decken, treten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen schädliche psychische und soziale Folgen häufiger auf als bei Erwachsenen. Ein gewohnheitsmäßiger Konsum bei Jugendlichen ist vergleichsweise häufiger als bei älteren Erwachsenen ein problematischer und abhängiger Konsum.
Hanfblatt: Immer wieder wird darum gestritten, warum man nicht gleich zur medizinischen Anwendung die als Genussmittel bereits bewährten getrockneten Hanfblüten oder das daraus gewonnene Harz oder einen Extrakt verschreibt, anstatt sehr teure industriell gewonnene Reinsubstanzen. Wo liegen hier kurzgesagt die Vor- und Nachteile? Oder anders gefragt, braucht man die Hanfpflanze dann eigentlich überhaupt noch, wenn man alle sinnvollen Präparate auf chemischem Wege synthetisieren kann?
Grotenhermen: Synthetisches THC bietet keine relevanten Vorteile gegenüber natürlichem Cannabis. Alles, was gegen eine Verwendung sonst illegaler Cannabisprodukte vorgebracht wird, wie etwa fehlende Reinheit oder mangelnde Standardisierung, sind in Wahrheit Argumente gegen ihre Illegalität, da sie bei einem legalen Zugang gut kontrolliert werden könnten. Die Frage, ob man Hanf noch braucht, wenn man synthetisches THC hat, stellt sich eigentlich umgekehrt: Synthetisches THC wird eigentlich nicht gebraucht, weil es Hanf gibt. Die Vorlieben der Ärzte und Patienten hinsichtlich definierter Einzelstoffe und natürlicher Kombinationspräparaten variieren allerdings, so dass ich dafür plädiere, beides anzubieten: Einzelsubstanzen und Ganzpflanzenzubereitungen. Zudem gibt es Hinweise auf Unterschiede hinsichtlich Wirksamkeit und Verträglichkeit bei zumindest einigen Patienten, ein Thema, das allerdings bisher nicht durch kontrollierte Untersuchungen geklärt wurde. Vorteile gegenüber Cannabinoiden wie THC, die psychische Effekte ausüben, weisen einige nicht-psychotrope Cannabinoide auf, die sich heute in klinischen Studien befinden, darunter Dexanabinol und CT-3 (ajulämische Säure). Diese synthetischen Cannabinoide decken allerdings nur einen Teil des therapeutischen Potenzials von THC bzw. Cannabis ab, da eine Anzahl von Wirkungen über Cannabinoidrezeptoren vermittelt wird, die auch psychische Wirkungen hervorrufen. CT-3 wird gegen entzündlich bedingte Schmerzen, wie beispielsweise chronische Gelenkentzündungen getestet. Es wirkt etwa so wie Aspirin, ohne allerdings mit den Aspirin-typischen Nebenwirkungen auf Magen und Nieren verbunden zu sein. Zum Thema THC, synthetische Cannabinoide und pflanzliches Cannabis vertrete ich die Auffassung, dass alles verfügbar gemacht werden sollte, wenn es mit einem echten Nutzen für die Behandlung von Kranken verbunden ist.
Hanfblatt: Cannabisfreunde versprechen sich von der Debatte um die medizinischen Nutzungsmöglichkeiten der Hanfpflanze nicht nur eine Versorgung teilweise schwer Kranker mit einer gut verträglichen Medizin, sondern auch eine Entspannung im Umgang der Gesellschaft und der Strafverfolgungsbehörden mit denjenigen, die Hanf einfach nur als Genussmittel konsumieren. Manche gehen da sogar soweit, sich vorzustellen, man könne dann in Ruhe sein Pfeifchen schmauchen, das wäre dann ja Medizin, gut gegen Alles sozusagen. Wie schätzen Sie da die gesellschaftlichen Perspektiven ein, wenn es zu einer erleichterten und häufigeren Verschreibung von Cannabispräparaten kommen sollte?
Grotenhermen: Die Diskussion um die medizinische Verwendung von Cannabisprodukten hat erheblich dazu beigetragen, die Diskussion um den Genuss- oder Freizeitkonsum zu versachlichen, denn im Zusammenhang mit der therapeutischen Verwendung taucht automatisch die Frage möglicher Nebenwirkungen und ihres Ausmaßes auf, beispielsweise die Frage: Schadet langzeitiger Cannabiskonsum der geistigen Leistungsfähigkeit? Zudem führt die medizinische Cannabisverwendung dazu, dass viele Menschen Patienten, ihre Verwandten und Ärzte einen legalen Kontakt mit der Droge bekommen. Meistens stellen sie dabei fest, dass die Warnungen vor den Nebenwirkungen in den vergangenen Jahren übertrieben waren, dass Cannabis bzw. THC sogar überwiegend sehr gut verträglich sind. Die medizinische Verwendung von Cannabis ist in der Lage, das Image der Pflanze auch bei solchen Personen positiv zu verändern, die bisher ein übertrieben negatives Bild von ihr hatten. Andererseits muss man natürlich sagen, dass Medikamente im Allgemeinen nicht gesund sind, sondern der Behandlung von Krankheiten dienen. Aus dem gelegentlich zur Rechtfertigung für den eigenen Konsum vorgetragenen Argument, Cannabis sei schließlich eine Medizin, kann daher im Umkehrschluss nicht gefolgert werden, Cannabiskonsum sei gesund für Gesunde. Die Frage, ob Cannabis auch für Gesunde positive Auswirkungen auf Leben und Befinden haben kann, entscheidet sich an der Frage des verantwortlichen Umgangs mit der Droge. Die Droge selbst ist dafür kein Garant.
Hanfblatt: Immer wieder lösen sich aus Medizinerkreisen die großen Warner, die den konservativen Kräften im Staatsapparat genehm, mit dem erhobenen Zeigefinger vor den schrecklichen Gefahren einer Verharmlosung und Entkriminalisierung eines schrecklichen Rauschgiftes warnen, um möglichst viele Forschungsgelder zum Beweis, dessen, was man insgeheim bereits bewiesen glaubt, abzuzweigen und sich als Gesundheitsapostel und selbsternannte Drogenexperten auf dem Medizinerolymp zu etablieren. Wie soll man diesen aus meiner Sicht an einer dogmatischen auf Gängelung basierenden Gesellschaft klebenden Feinden der freien persönlichen Lebensentfaltung gegenübertreten? Oder anders gefragt: Wird es jemals einen rationalen Umgang mit Cannabis und Cannabinoiden geben?
Grotenhermen: Nach meinem Eindruck haben sich die öffentliche Wahrnehmung und das Diskussionsniveau bereits merklich im Sinne eines rationalen Umgangs verändert. Dies ist ein Prozess, der sich wie alle Veränderungen, die Einstellungsänderungen voraussetzen, nur langsam vollzieht. Ich erfahre auch heute noch regelmäßig von Patienten, die ihren Arzt auf die Verschreibung von THC (Dronabinol) angesprochen haben, dass er dies mit dem Hinweis, er würde keine Drogensucht fördern, oder mit ähnlich ignoranten Bemerkungen grundsätzlich ausgeschlossen hat. Aber dennoch sind viele gesellschaftlich relevante Gruppen wie Journalisten, Mediziner, Juristen und auch Politiker heute insgesamt besser informiert als vor 10 Jahren. Aber es ist auch richtig, dass das Thema Cannabis auch heute noch vielen Eltern, Politikern und anderen Personengruppen Angst macht, was rationales Handeln manchmal erschwert. Die Ängste muss man übrigens ernst nehmen. Mit dem Thema Konservativismus wird zusätzlich ein Aspekt angesprochen, der über den Bereich des rationalen Umgangs mit Drogen hinausgeht. Konservativismus beinhaltet Haltungen, die nicht nur im Drogenbereich moralisierend und normierend massive Eingriffe in das Privatleben rechtfertigen oder als notwendig erachten, beispielsweise auch wenn es um den so genannten Kampf gegen den Terrorismus geht. Der rationale Umgang mit Cannabis oder anderen Drogen führt also nicht automatisch dazu, dass gängelnde Einschränkungen der individuellen Freiheiten verschwinden werden. In den letzten Jahren hat sich auch die Argumentation zur Rechtfertigung des Cannabisverbotes verschoben bzw. verändert. Wurde früher vor allem die Gefährlichkeit der Droge, auch im Vergleich zu Tabak und Alkohol, betont, so heißt es heute oft, Tabak und Alkohol würden bereits große gesundheitliche und soziale Schäden anrichten, die nicht durch die Legalisierung einer weiteren Droge vergrößert werden sollten. Solche Argumentationsverschiebungen stellen nicht nur ein Eingeständnis dar, dass die frühere Propaganda oder Überzeugung falsch war, sondern auch dass Prohibitionsbefürworter durchaus flexibel reagieren, beim Versuch, den gegenwärtigen Zustand zu erhalten. Ich bin kein Hellseher und kann nicht sagen, wohin die Entwicklung letztlich führt. Nach meinem Eindruck funktioniert die Bewegung im Cannabisbereich seit vielen Jahren wie bei der Echternacher Springprozession: Zwei Schritte vor, einer zurück. Da bleibt ja als positive Differenz immerhin ein Schritt nach vorn.