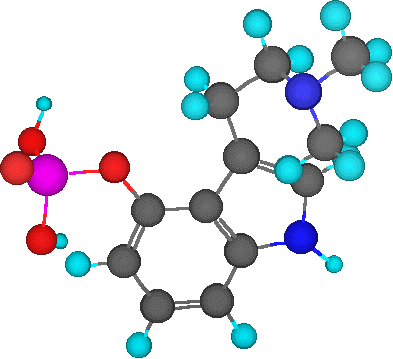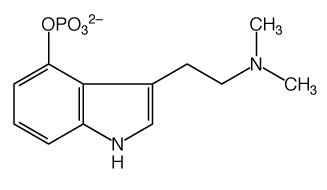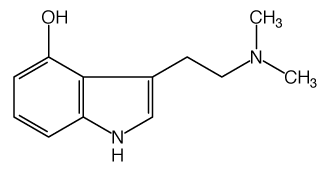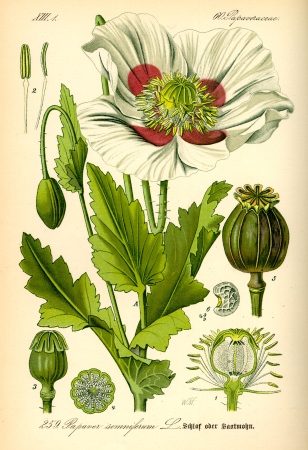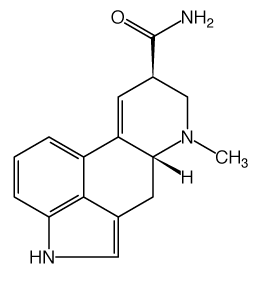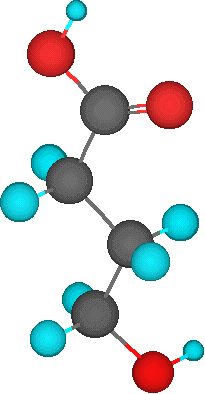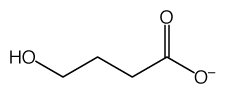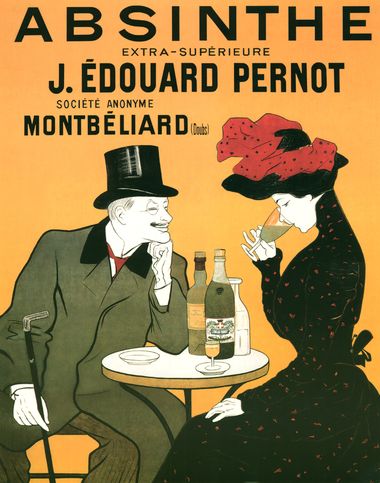1,4-Butandiol
Über 1,4-Butandiol ist bisher (12/98) noch nicht allzuviel bekannt. Es gilt als Ersatz für das unter der Bezeichnung „Liquid Ecstasy“ zuerst in den US-Medien und jetzt auch in Deutschland verteufelte GHB (Gamma-Hydroxy-Butyrat). Mal wieder ist eine neue „Horrordroge“ am Start. Das macht neugierig und man will mehr wissen, und zwar die vorhandenen „Facts“ und nicht das zur Lachnummer degenerierte „volksverhetzende“ Propaganda-Geschwafel der offiziellen Antidrogenpolitiker und der sensationsgeilen Journaille.
Wer alles Wichtige über GHB und damit letztlich auch über 1,4-Butandiol erfahren will, der sollte sich „GHB-The Natural Mood Enhancer“ von Ward Dean, John Morgenthaler und Steven Wm. Fowkes, erschienen 1998 bei Smart Publications, PO Box 4667, Petaluma, CA 94955, ISBN 0-96227418-6-8, bestellen. Dort wird auch beschrieben, wie sich aus frei erhältlichen Chemikalien (Gamma-Butyro-Lacton, kurz GBL, und Natriumhydroxid bzw. alternativ andere basische Salze) auf einfache Weise GHB-Salz synthetisieren läßt. Man sollte bedenken, daß dieses fachkundige Buch von dem verantwortungsbewußten rekreativen und mehr noch dem medizinischen Einsatz von GHB gegenüber positiv eingestellten Autoren stammt. GHB mag bei weitem nicht so gefährlich sein, wie es sensationshungrige Medien weismachen wollen, dennoch gibt es eine ganze Reihe ernstzunehmender Mediziner, die vor dem verantwortungslosen Gebrauch, möglicherweise noch in Kombination mit anderen psychoaktiven Drogen, warnen!
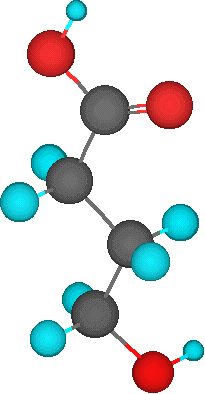 GHB
GHB
Sowohl 1,4-Butandiol als auch GBL lassen sich problemlos im Chemikalienfachhandel bestellen, über Internet beispielsweise zum Preis von 15,25 DM für 250 Gramm 1,4-Butandiol, ca. 99% rein, oder 12,80 DM für 100 ml gamma-Butyrolacton 99+%. Dazu kommen natürlich noch Bestell- und Versandkosten. Der Versand erfolgt per Post direkt nach Hause.
In der Chemie wird 1,4-Butandiol wegen seiner hygroskopischen und weichmachenden Eigenschaften an Stelle von Glycerin und Glycol verwendet und zwar in der Textil- und Papierindustrie und zur Rauchwarenveredlung! Es ist außerdem ein wichtiges Zwischenprodukt zur Synthese anderer Chemikalien, unter anderem auch von Butyrolacton! (Siehe „Fachlexikon ABC Chemie“)
1,4-Butandiol hat eine Molmasse von 90,12 und eine Dichte von 1,02, das heißt 1 Milliliter (ml) wiegt ungefähr 1 Gramm! (so wie Wasser!)
1,4-Butandiol, in der Chemie auch 1,4-Butylenglycol genannt, schmilzt bei etwa 20 °C. Die farblosen Kristalle oder die weiße Kristallmasse verwandeln sich in eine klare Flüssigkeit. Wenn es ersteinmal flüssig oder fest ist, bleibt es meist eine Zeit lang in dem entsprechenden Aggregatzustand. Zur Aufbewahrung eignen sich am besten gut verschließbare braune Glasflaschen. Zum Konsum wird die flüssige Form bevorzugt. Verfestigtes 1,4-Butandiol kann in Heizungsnähe leicht wieder verflüssigt werden. Es läßt sich gut mit Hilfe einer Pipette mit Meßskala entnehmen und dosieren. Flaschen mit Pipettenverschluß sind demnach ideal.
Bei einer Temperatur von 134 °C ist 1,4- Butandiol entflammbar! Bei 230 °C verdampft es. Im Chemikalienhandel wird es als schwach wassergefährdender Stoff und gesundheitsschädlich kategorisiert. Es reize die Augen und die Haut und sei gesundheitsschädlich beim Verschlucken! Bei Berührung mit den Augen sollen diese gründlich mit Wasser abgespült und ein Arzt konsultiert werden.
Das Lycaeum-Drogenarchiv im Internet warnt vor der Einnahme von 1,4-Butandiol und GBL. Beide Substanzen könnten Krankheit verursachen, selbst wenn sie nur leicht unrein seien. Industrielle und technische Produkte sollten als ungeeignet für menschlichen Konsum angesehen werden.
Mit Hinweis auf die entsprechende Fachliteratur wird dort im Internet, nachlesbar unter www.lycaeum.org, berichtet, daß das pharmakologische und toxikologische Profil von 1,4-Butandiol, wie von GBL, mit dem von GHB praktisch identisch seien, da diese Substanzen im tierischen und menschlichen Körper schnell und umfassend zu GHB umgewandelt würden, dieses dann seine typischen Wirkungen entfalte und dann eben als GHB entsprechend schnell und vollständig abgebaut würde. Demzufolge sind von diesen Substanzen weder krebserregende noch organschädigende Wirkungen zu erwarten. Dieser zwar zunächst entwarndende, aber dürftige Informationsstand sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß über mögliche gehirn- oder andere Organe schädigende Wirkungen des 1,4-Butandiols praktisch noch nichts bekannt ist. Selbst wenn die Risiken ähnlich einzuschätzen sind wie bei GHB, so bleibt immer noch die Frage offen, ob nicht chemische Verunreinigungen mögliche nachteilige Wirkungen entfalten könnten. Selbst bei nur 1% Verunreinigung wären an einer Dosis von 3 ml immerhin 30 Milligram (mg, also 0,03 Gramm) unbekannter Substanzen beteiligt. Es wäre wichtig herauszufinden um welche Verunreinigungen es sich jeweils handelt oder handeln kann und welche toxischen Risiken mit ihnen verbunden sind. Derartige Risiken sind übrigens bei aus verunreinigten Ausgangssubstanzen synthetisiertem Schwarzmarkt-GHB noch erheblich höher einzuschätzen.
1,4-Butandiol ist auf Grund seiner psychoaktiven Wirkungen bereits stark überteuert quasi als psychoaktives Schlangenöl verkauft worden. Unter der Bezeichnung „Borametz“ sollte es sich um einen angeblich aus Rußland stammenden Pflanzenextrakt handeln. Diesen „Borametz-Schwindel“ hat John Hanna aufgeklärt. Sein umfangreicher und sehr interessanter Bericht, der auch weitere Hintergründe zu 1,4-Butandiol liefert, erschien in der lesenswerten Zeitschrift „TRP“, Kurzform für „The Resonance Project“, Ausgabe Nr. 2, Winter 1997/98, siehe im Internet unter www.resproject.com. Mit einem psychoaktiven Produkt, dessen Risiken kaum bekannt sind, Profit machen zu wollen, ist verantwortungslos! In diesem Falle sind sogar schon eine Reihe von Risiken bekannt, nämlich die, die für GHB gelten. Besonders bei Verbreitung in einer leichtfertig diverse psychoaktive Substanzen gleichzeitig konsumierenden Szene, wie zum Beispiel auf Technoparties, bestehen hohe Risiken negativer Reaktionen!
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an überteuerten GHB-Ersatzmixturen, die die ein oder andere Vorläufersubstanz als wirksame Grundlage enthalten. Die Präparate heissen zum Beispiel „Gamma-G“ („40 Dosis-Flasche für 89.95 $“, „High Times“-Anzeige 3/99), „Revivarant“ oder „Renewtrient“. Vermutlich GBL wird in den USA seit August 1998 als „Blue Nitro“ verkauft. Der Umsatz soll sich bei steigender Tendenz auf über 5000 Flaschen pro Woche belaufen, bei einem Preis von 64.95 $ pro Flasche. ( Siehe San Francisco Examiner, 11. 01.1999)
Die Verkaufsmedien für diesen Handel sind Internet, einschlägige Magazine, Sex-Shops, Techno-Parties, Smart-Shops etc.. Die obskure Substanz 4-Hydroxy-2-Furanon, die im Körper angeblich auch in GHB umgewandelt wird, wird in affiger Sex-Shop-tauglicher Verpackung, in den Niederlanden als „G-Spot“, ein „vitaminangereichertes Aphrodisiakum“ „als diätischer Zusatz“ vertrieben. Die Smartshops, die das simple Präparat verkaufen, verlangen 25 Gulden für eine Dosis. Man erhält eine primitive Plastikflasche mit 15 ml eines ekelhaft schmeckenden Gebräus, dessen Wirkung vielleicht 1 bis 1,5 ml 1,4-Butandiol entspricht. Wenn man das nicht Wucher nennen darf! Hier geht es um die schnelle Mark ohne Rücksicht auf Verluste.
Tatsache ist aber auch, daß 1,4-Butandiol mittlerweile zunehmend als leicht erhältlicher preiswerter Ersatz für GHB eingenommen wird, sicherlich eine Folge der Kriminalisierung von GHB. In der Szene wird es auch bezeichnet als „Einsvier“ (für 1,4), „Einsvierbe“ (1,4-B), „Oneforbe“ (Englisch ausgesprochen), „Butandiol“ (davon gibt es allerdings noch andere nicht psychoaktiv wirksame Varianten), „Liquid“, „Liquid Ecstasy“ (so werden auch GHB und praktisch unwirksame Smart-Shop-Plagiate genannt) und „Borametz“ (nach dem Schwindelprodukt). Außerdem wird es noch mit anderen „Kosenamen“ belegt. Der Phantasie der Konsumenten sind da keine Grenzen gesetzt. („Love Potion Number Zwei ?“).
Obwohl es nicht selten pur geschluckt wird, möchte ich davon nicht nur wegen dem Geschmack nach verbranntem Plastik, sondern wegen möglicher schleimhautreizender Wirkungen abraten. 100 %iger Alkohol ist auch nicht sonderlich schleimhautverträglich.
Weniger bedenklich erscheint das (übrigens problemlose) Einrühren einer Dosis in 200 bis 300ml (einem großen Glas) Fruchtsaft (nicht Milch!). Eingenommen wird das geschmacklich verträgliche Gebräu damit es schneller und intensiver wirkt auf möglichst nüchternen Magen, einige Stunden nach der letzten Mahlzeit.
Bei 1,4-Butandiolkonsum sollte Alkohol vermieden werden. Vorher eingenommen scheint er das Gefühl für die spezifischen 1,4-Butandiol-Wirkungen zu verringern. Obendrein verstärkt er die dämpfenden und auch andere eher unangenehme Wirkungen wie Schwindelgefühl und Übelkeit. Er erhöht, wenn beide Substanzen gleichzeitig in stärkerer Dosis eingenommen werden, drastisch das Risiko gefährlicher Reaktionen.
Ähnliche Warnungen gelten für alle Arten von Downern. Barbiturate, Benzodiazepine, Opiate usw. können in Kombination mit 1,4-Butandiol zu gefährlichen Komplikationen, unter Umständen möglicherweise bis zum Tod durch Atemstillstand führen.
Auch von der Kombination mit Aufputschmitteln wie Amphetamin, Ephedrin und Kokain muß dringend abgeraten werden. Das gilt auch für „Ecstasy“ (MDMA et. al.). Negative Wirkungsverstärkungen in Sachen Herz-Kreislaufsystem sind denkbar. Genaue Untersuchungen über Wechselwirkungen stehen noch aus.
Coffein gilt als natürlicher Blocker der GHB- und damit wohl auch der 1,4-Butandiol-Wirkungen. Dadurch besteht in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, auftretende Müdigkeit und Duseligkeit mit einer starken Tasse Kaffee oder dergleichen zu bekämpfen oder die Ernüchterung zu forcieren. Andererseits blockiert Coffein vorher genommen die volle Entfaltung der Wirkungen, was meist ja nicht erwünscht ist.
Cannabis (Rauschhanf) vor Einnahme von 1,4-Butandiol geraucht, verstärkt die einschläfernden Wirkungen von 1,4-Butandiol. Die Kombination forciert mitunter ein Driften in einen träumerischen Halbschlaf, der schließlich in (evtl. unruhigen) traumreichen Schlaf übergehen mag. Es ist auch möglich, daß das bei höheren Dosierungen beider Substanzen auftretende Gefühl des „Bedröhntseins“ sich noch verstärkt. Nimmt man jedoch zuerst das 1,4-Butandiol ein, dann kann sich ein „Stonedsein“ mit einer eigenartigen etwas abgetretenen chemisch-spacigen Note einstellen. Das Wohlgefühl vom 1,4-Butandiol mag sich dabei verstärken, die veränderte Wahrnehmung der Sinne und damit der Umwelt auch. Wer generell Angst vor Bewußtseinsveränderung hat, dem sei von dieser Kombination abgeraten.
Als Schlaf- und Entspannungsmittel nach anstrengenden Psychedelika-Trips ist 1,4-Butandiol nicht unbekannt.
Letztlich scheinen sich die 1,4-Butandiol-Wirkungen am besten auf nüchterenen Magen und ohne vorher irgendeine andere psychoaktive Substanz genommen zu haben, zu entfalten. Auch das Risiko unangenehmer Wirkungen wird so reduziert.
Zu den Dosierungen ist folgendes zu sagen: Jeder Konsument muß seine individuelle Sensibilität ermitteln. Diese mag von Fall zu Fall deutlich schwanken. Einige Faktoren sind ja bereits angesprochen worden. Viel hängt von der persönlichen Stimmungslage, der körperlichen Verfassung, wie z.B. Müdigkeit oder Aufgekratztheit, ab. In welchem Umfeld und zu welchem Zeitpunkt man die Substanz nimmt und mit wem ist äußerst bedeutend. Eine relaxede Atmosphäre mit alten Freunden oder vertrauenswürdigen neuen Freunden scheint ideal. Auf der Strasse oder auf unübersichtlichen hektischen Parties ist 1,4-Butandiol kontraindiziert. Ein gewisses Risiko besteht nämlich in einer Überdosierung. Weil es so schön ist, nimmt man einfach immer mehr und schließlich eine einschläfernde Überdosis. An sich zwar relativ ungefährlich, wenn ausschließlich 1,4-Butandiol genommen wurde, kann sie schon innerhalb einer viertel bis halben Stunde zu einem tiefen komaähnlich erscheinenden Schlaf führen. Dieser soll zwar nach 3 bis 5 Stunden beendet sein, der Betreffende erwacht wohl in der Regel entspannt und erfrischt. Tritt der Zustand allerdings an einem ungünstigen Ort auf, besteht die Gefahr der Vorteilnahme durch Andere (sexuell oder materiell) oder von Überreaktionen uninformierter Freunde oder Beisteher, sprich Rufen der Notfallambulanz, die dann mit eigentlich unnötigen unangenehmen „Wiederbelebungsmaßnahmen“ beginnt. Ein reales Risiko ist auch das des Erbrechens während der Bewußtlosigkeit, wenn man sich nicht an die obigen Abstinenzregeln gehalten hat. Die Kombination mit anderen Drogen macht das Risiko von Atemstillstand und anderen Komplikationen schwer abschätzbar. Hier ist der Notfallarzt möglicherweise doch der richtige Partner auf dem Weg zur Ernüchterung. Aber soweit muß man es ja nicht kommen lassen. Eine übliche Sicherheitsmaßnahme ist es, wenn Freunde gegenseitig aufeinander aufpassen, sich auch über die Drogen zu informieren, die man genommen hat, damit im Notfall das entsprechende Wissen an den behandelnden Arzt weitergeben werden und dieser dann die (hoffentlich) richtigen Maßnahmen einleiten kann.
GHB und seine Ersatzaanaloge haben einen gewissen Ruf als „Date-Rape-Droge“. Generell sollte frau ihre Drinks in Anwesenheit dubioser Typen im Auge behalten. Alkohol und Benzodiazepine sind die klassischen Drogen um (meist) eine Frau gegen ihren Willen gefügig zu machen.
Ich möchte jetzt noch ein paar subjektive (!) Anhaltspunkte zur Dosierung geben:
Auf nüchternen Magen, ohne vorherige Einnahme anderer psychoaktiver Substanzen und ohne ausgeprägte Müdigkeit, wirken 1 bis 1,5 ml 1,4-Butandiol bereits subtil. Da sie die Sensibilität für Berührungen erhöhen und leicht enthemmen, aber bei Männern in der Regel kaum mit der Erektionsfähigkeit ins Gehege kommen, stellen sie eine ideale aphrodisische Dosis dar. Dies mag auch bei 2ml noch der Fall sein. Das Erreichen von Erektion und Orgasmus können dann aber verzögert sein. Dafür werden Sex und Orgasmus vielleicht intensiver erlebt. (GHB ist in den USA auch bei manchen Gruppensexfans beliebt.) Ab dieser Dosis (2ml) ist ein deutlicher „Törn“ oder „Rush“ spürbar. Nach bereits 5 Minuten schwach, nach 10 Minuten deutlich, entfaltet sich eine kräftig verstärkende Wirkung. Diese schönste Phase hält etwa eine Stunde an. Eine halbe bis eine Stunde bleibt die Wirkung auf dem erreichten Niveau, um dann über etwa eine Stunde auf Normalnull abzuflachen. Nach 3 bis 4 Stunden ist wieder weitgehende Nüchternheit, vielleicht mit einem euphorischen Nachhall, hergestellt. Gewisse entspannende körperliche Nachwirkungen, auch als Mattheit oder Müdigkeit empfunden, mögen länger, eventuell noch am nächsten Tag, spürbar sein. Der Schlaf kann besonders bei Menschen ohne Schlafprobleme gestört sein, was sich durch zwar erleichtertes Einschlafen aber vorzeitiges Aufwachen nach 3 bis 5 Stunden auszeichnet. Allerdings fühlt man sich dann meistens relativ frisch.
Die eigentliche Wirkung von 1,4-Butandiol ist geprägt durch ein angenehmes erotisches, sinnliches an „Ecstasy“ erinnerndes Körpergefühl. Atmen, Streicheln, Räkeln und Massieren, vielleicht auch Kopulieren, sanfte körperliche Entspannungsübungen oder wiegender Tanz kommen angenehm. Dabei fließt gleichzeitig eine ganz schön starke unruhige aber angenehme an Kokain erinnernde innere Energie. Enthemmung und erhöhte Emotionalität vermögen den Gedanken- und Gesprächsfluß ähnlich wie bei Alkohol und MDMA zunächst kräftig anzuregen. Dabei kann es zu einer in manchen Stadien des Alkoholrausches ebenfalls auftretenden Sentimentalität (z.B. vom Stile, „erinnerst du dich noch, die alten Zeiten“) kommen. Die damit einhergehende, an MDMA erinnernde, freundliche bis herzliche aber nicht haltlose Neigung zu einer liebevollen Öffnung (nach dem Motto, „was ich dir immer schon mal Gutes sagen wollte“) und die bestehenbleibende Bewußtheit für die eigene Befindlichkeit lassen die Öffnung aber deutlich ehrlicher, persönlicher, sympathischer und haltbarer als üblicherweise im Alkoholrausch erscheinen. Das unterscheidet den 1,4-Butandiol-Törn auch vom egomanischen Redeschwall unter Kokain- oder Amphetamineinfluß. Im Einzelfall kann es aber durchaus zu lautem rechthaberischen und aggressiven Gebaren kommen. Da das Ausagieren aufgrund des dennoch vorhandenen körperlichen Wohlgefühls und mangelnder Koordinationsfähigkeit oder Torkeligkeit in der Regel gedämpft ist, kommt es wohl selten zu ernsthaften Auseinandersetzungen unter 1,4-Butandioleinfluß. Erst bei höheren oder wiederholten Dosierungen stellt sich eine vorübergehende Gedächtnisschwäche mit Problemen, sich an kurz zuvor Gedachtes zu erinnern oder passende Worte zu finden, und ein reduzierter Gedankenfluß ein, ein bedröhntes Driften in die eigene innere körperliche Welt bis hin zum ständigen Wegnicken, das allerdings nicht unbedingt als unangenehm empfunden wird. Im Gegensatz zu Opiaten, die einen in die wohlige selbstgenügsame und desinteressierte Isolation zurückzuwerfen vermögen, bleibt die generelle mentale Bereitschaft zum Kontakt mit dem Anderen und der Außenwelt reizvoll und erhalten, selbst wenn die Fähigkeit dazu am schwinden ist. Die Qualität des Denkens und der äußerlichen Wahrnehmungen scheint sich nicht so zu verändern wie es unter Einfluß von Cannabis oder Psychedelika der Fall ist. In diesem Sinne wirkt 1,4-Butandiol allein nicht psychedelisch.
Positive fließende Musik, schmelzige eingängige Sounds und fluffige Melodien und Rhythmen wirken allerdings verstärkt mitreissend und euphorisierend. (Erlebt bei Technomusik und der Schnulze „Liquido“ von „Narcotic“, die wie die Faust aufs 1,4-Butandiol, das auch „Liquid“ genannt wird, zu passen schien.) Die Fähigkeit, sich auf Langweiliges oder Hektisches zu konzentrieren, besonders optisch, wird mit zunehmender Dosis fortschreitend reduziert. Das Reaktionsvermögen ist schon bei niedriger Dosis eingeschränkt! Besonders unter Einfluß höherer Dosierungen sollte man nichts unternehmen bei dem Taumeligkeit, Konzentrations- und Koordinationsstörungen Beeinträchtigungen darstellen.
2,5 ml 1,4-Butandiol stellen eine Dosis dar, die die meisten Menschen schon kräftig beschwingt aber gut kommunikationsfähig beläßt. Bei einer Dosis von 3 ml stellt sich in der Regel ein starker euphorischer aber auch kräftig beduselnder Törn ein. Eine Dosis von 4 ml soll bereits schlaffördernd wirken.
Zur Nachdosierung wartet man entweder bis etwa 2 oder 3 Stunden nach Einnahme der ersten Dosis und entscheidet dann, ob man den ersten Rausch noch toppen will. Der zweite Törn wird insbesondere dann ein wenig stumpfsinniger ausfallen, wenn man gierig wird, mehr will und eine höhere Dosis einnimmt. Wer unbedingt gezielt den Anfangstörn verlängern will, der nimmt bereits nach Erreichen des Plateaus, also etwa nach einer Stunde eine zweite Dosis, die allerdings nur etwa die Hälte der vorhergegangenen Dosis oder weniger betragen sollte, wenn man auf dem gleichen Niveau bleiben will. Mehr als zwei, allenfalls drei Dosierungen sind nicht zu empfehlen. Das Schöne des Rausches schwindet dann schnell zu Ungunsten einer unkreativen Bedröhntheit. In der Praxis allerdings werden sicherlich eine Reihe begeisterter Probierer erstmal übertrieben „auf die Kacke hauen“, bis sie (hoffentlich) ihre persönlichen Grenzen gefunden haben. Es bleibt nur zu hoffen, daß diese Experimentiererei nicht auf Kosten der Gesundheit geht. Über die möglichen Langzeitfolgen für Leber, Nieren, Herz, Gehirn usw. ist noch nichts bekannt! Deshalb muß vor dem experimentellen Gebrauch von 1,4-Butandiol eindringlich gewarnt werden! 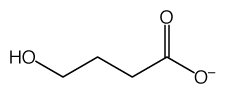
Der Törn ist bei höheren Dosierungen von einem zunehmenden Schwindelgefühl und einer Torkeligkeit begleitet, die an späte Stadien des Alkoholrausches erinnert, aber bereits spätestens beim Abklingen der Wirkung wieder schwindet. Ein gewisser Kopfdruck bis hin zu Kopfschmerzen kann als weniger angenehme Wirkung auftreten. Schon vorhandene Kopfschmerzen werden wahrscheinlich bestehen bleiben. Die Kombination mit anderen Drogen (z.B. Stimulantien und Alkohol) scheint das Risiko von Kopfschmerzen zu erhöhen. 1,4-Butandiol scheint auch harntreibend zu wirken. Ein guter Flüssigkeitsumsatz ist zum Schutz vor schleimhautreizenden Wirkungen und zum beschleunigten Ausschwemmen potentiell schädlicher Nebenprodukte wahrscheinlich nicht verkehrt. Ein leichter Magendruck und Sodbrennen wurden als unangenehme Wirkungen genannt. Übelkeit kann bei hohen Dosierungen und besonders bei vollem Magen auftreten. Im Anschluß an die Wirkung kann in der Regel problemlos und mit gutem Appetit gegessen werden.
Die Wirkung ist wie so oft beim ersten Mal am schönsten, vorausgesetzt die Umstände stimmen. Konsumenten sind begeistert von dem sinnlichen Körpergefühl, „natural beauty“, der „Körpergefühldroge“, dem kräftigen, enthemmenden, duseligen „Schwindeltörn“, der „ganz gut reinknödelt“. Wird die Substanz allerdings nachlässig eingenommen, können die körperlichen Empfindungen als nicht ganz so angenehm empfunden werden. Müdigkeit mag dominieren, die eingeschränkte Fähigkeit zu Denken und zu Handeln mag als nervig empfunden werden. Alles hat eben mindestens zwei Seiten. Und keineswegs sollte man es mit der Einnahme dieser noch wenig bekannten Substanz übertreiben. Bei suchtgefährdeten Personen ist ein Risiko eines zumindest vorübergehenden exzessiven Gebrauchs gegeben! Nur die sporadische Einnahme zu passenden Gelegenheiten garantiert den höchsten Genuß. Neugierige sollten trotz der vielleicht verlockend klingenden psychoaktiven Wirkungen Zurückhaltung üben bis Näheres über eventuelle weitergehende gesundheitliche Risiken von 1,4-Butandiol bekannt ist!
az