Wunderschön üppig in gelbgrün blüht auf meinem Fensterbrett der Bauerntabak. Ich kann ihn gar nicht genug bewundern. Da erschüttert ein Anruf mein tristes Dasein. Es ist mein Kollege, der rasende Reporter: „Special Tabak, alles klar?!“ Na gut, „Bröselmaschine“ in den CD-Player eingeschoben, und los gehts.
Nie zuvor wurde auf diesem Planeten so viel Tabak konsumiert, wie heute, und die Zahl der Konsumenten ist, weltweit gesehen, immer noch im Steigen begriffen. In Folge der „Entdeckung“ Amerikas durch Columbus im Jahre 1492 und damit auch des Tabaks verbreitete sich nach einer Anfangsphase, in der er in Europa zunächst hauptsächlich als Heil- und Zierpflanze genutzt wurde, der den „Indianern“ abgeschaute Tabakkonsum (Rauchen, Schnupfen, Kauen) bis in die entlegensten Winkel der Welt. Dabei entspannen sich immer wieder Debatten und gab es örtlich Verfolgungen, die den gegenwärtig geführten in Sachen Cannabis nicht nachstanden (siehe „Smoke“ von Gilman/Xun (Hrsg.)).
Ein Drittel der erwachsenen Weltbevölkerung konsumiert mittlerweile Tabak, hauptsächlich in Form des Rauchens von Zigaretten, welches sich nachdem 1881 in den USA die erste Maschine zur massenhaften Zigaretten-Fabrikation entwickelt worden war, im 20. Jahrhundert als die zeitgemäße, der allgemeinen Beschleunigung Rechnung tragende, ohne großes Brimborium, selbst im Schützengraben unter Beschuss, vollziehbare Konsumform etabliert hat. Als Besonderheit halten sich in Indien noch Bidis (in ein Temburni-Blatt eingewickelter Tabak) und in Indonesien Kretek (Gewürznelkenzigaretten, siehe Hanusz „Kretek“). Obendrein wird dem nach wie vor in Süd(ost)asien verbreiteten Betelbissen oft Kautabak zugesetzt. In Deutschland sind aber Tabakkauen und -schnupfen, obwohl sie kurioserweise seit 1993 tabaksteuerfrei sind, aus der Mode gekommen. Dem Pfeiferauchen haftet der Muff des Antiquierten an. Lediglich das Rauchen von Zigarren, symbolisch für das erstarkende Bürgertum und den aufkommenden Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, findet, heute als Zeichen von Status und Geschmack beworben, immer noch seine Liebhaber. Bonbonartig aromatisierten Tabak aus kitschigen Wasserpfeifen zu qualmen, ist ein modischer Trend aus der islamischen Welt, der in letzter Zeit in entsprechendem Ambiente als stilvoll propagiert wird. Immerhin saugten schon Promis wie Willy Brandt und Angela Merkel am Schlauch, frei nach dem Motto „Ziehen, nicht Blasen“.
Schon vor 8000 Jahren soll Tabak angebaut worden sein. Diverse Nicotiana-Arten wurden von indianischen Kulturen genutzt (siehe Christian Rätsch „Schamanenpflanze Tabak“, 2 Bände). Nur der rosa-rot blühende Echte oder Virginische Tabak (Nicotiana tabacum) und untergeordnet der robustere und nikotinreichere Bauerntabak (Nicotiana rustica, in Rußland „Machorka“) haben sich zur Genussmittelproduktion etabliert. Einst im rituellen Kontext eingesetztes Hilfs- und Heilmittel der Schamanen, dann Inspiration für Dichter und Denker oder aber Treibstoff für Macher wie für Schwätzer, gilt Tabak heute als das profane Suchtgift schlechthin, ohne medizinischen Wert und mit tötlichen Folgen.

im Winter testweise mittels eines simplen (IKEA)-Hydrokultur-Systems angezogen.
Wenn Tabak erst einmal angewachsen ist, dann sprießt er….
Für das Jahr 2000 wird Tabak von der WHO für weltweit 4,2 Millionen vorzeitige Todesfälle verantwortlich gemacht (siehe WHO „The Tobacco Atlas“). In Deutschland schätzt man die Zahl der jährlich vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums sterbenden Menschen auf bis zu 140.000. Krebs, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen gelten als todbringende Folgen des Tabakkonsums. Je früher ein Raucher anfängt, und je mehr er täglich konsumiert, desto kürzer ist laut Statistik seine Lebenserwartung, desto höher das Risiko an Folgeerkrankungen wie Krebs, chronischer Bronchitis, Lungenerkrankungen, Augenschäden, Durchblutungsstörungen mit erhöhtem Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko und im Alter eventuell eher an Demenz zu leiden. Mögliche Hautveränderungen werden von Medizinern ebenfalls als Argument gegen den Tabakkonsum vorgebracht. (Siehe Haustein „Tabakabhängigkeit“). Der Zigarettenrauch enthält bis zu 70 krebsauslösende Substanzen, daneben andere bedenkliche Gifte, wie Kohlenmonoxid, Benzol und Cadmium.
Cannabis- und Kräuterzigarettenraucher sollten sich übrigens nicht in falscher Sicherheit wiegen: Auch der durch Verbrennung entstehende Rauch anderer Kräuter ist reich an Teer, potentiellen Karzinogenen und Giftstoffen.
Ein weiterer Nachteil des Qualms ist, dass durch das sogenannte Passivrauchen nicht nur der sich eigenverantwortlich seine Lunge Teerende, sondern auch die in seiner Atmosphäre aus Rauch leben müssenden Mitmenschen, beispielsweise Raucher-Kinder, Kollegen oder Besucher öffentlicher Veranstaltungen über die allgemeine Geruchsbelästigung hinaus gesundheitlich beeinträchtigt werden. Viele Nichtraucher sind nicht länger bereit, sich durch Raucher einschränken zu lassen.

Nikotin ist der charakteristische Hauptwirkstoff des Tabaks. Dieses Alkaloid wurde in reiner Form erstmals von Reimann und Posselt im Jahre 1828 an der Universität Heidelberg isoliert. Es wirkt aktivierend und gleichzeitig emotional dämpfend. Die Wirkung hält, in den als Genussmittel üblichen Dosen inhaliert, etwa 20-90 Minuten an, in höheren Dosen und oral eingenommen auch länger. Bei zu hoher Dosis kommt es zu Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Darmkontraktionen, Schweißausbrüchen und kollapsartigem Blutdruckabfall. Etwa 0,04 bis 0,06 Gramm reines Nikotin gelten für Erwachsene als potentiell tödliche Dosis. Kinder sind schon bei 0,01 Gramm gefährdet. Der Tod erfolgt durch Atemlähmung. Tabak enthält je nach Sorte und Verarbeitung zwischen 0,05 und bis zu 8 % Nikotin. Nikotindauerkonsum, egal in welcher Form, wird als Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die bekannten Durchblutungsstörungen („Raucherbein“) angesehen, die im späten Stadium Amputationen erforderlich machen. Auch der Potenz soll Nikotin nicht zuträglich sein. Nikotin wird ein hohes Suchtpotential zugesprochen. Der körperliche Nikotinentzug, eine allgemeine Mißstimmigkeit, dauert allerdings nur etwa 24 bis 48 Stunden. Das Verlangen nach Nikotin bleibt dagegen noch etwa 2 bis 4 Wochen erhalten. Es tritt später eventuell noch sporadisch auf. Um vor dem eigentlichen Nikotinentzug das Runterkommen von der Gewohnheit des Rauchens zu erleichtern, wird neuerdings mit pharmazeutischen Nikotinpflastern und -kaugummis aus der Apotheke „substituiert“, die manche Raucher als geradezu harten Stoff empfinden. Sie klagen über Schlafstörungen und Alpträume als „Nebenwirkungen“. Diverse Verhaltenstips, Entspannungsmethoden und therapeutische Hilfen zur Überwindung der Nikotinabhängigkeit werden angeboten, teilweise von den Krankenkassen finanziert. Ihre Effektivität steht und fällt im Einzelfall jedoch mit der generellen Bereitschaft des Rauchers, sein Verhalten wirklich ändern zu wollen.

Die Tabakindustrie bestritt jahrzehntelang den Zusammenhang zwischen ihrem Produkt und möglichen gesundheitlichen Folgen. Immer wieder konterte sie mit neuen angeblich risikomindernden Trends, wie einem niedrigen Nikotingehalt, der allerdings, wie sich herausstellte, ganz im Sinne der an Umsatzmaximierung interessierten Industrie, zu einer vermehrten kompensierenden Qualmerei führte. Der abhängige Konsument verlangt nämlich nach einem zünftigen Nikotin-Kick und danach seinen Nikotin-Pegel zu halten. Die Zigarettenfilter auf Celluloseacetat-Basis gerieten in Verruf, da ihre feinen Fasern auf die Dauer selbst möglicherweise krebsauslösend sind. Die zahlreichen industriellen Zusätze zur Verbesserung von Aroma, Brenneigenschaften, Geschmack, Inhalierbarkeit und Wirksamkeit, die durch das Beizen und Saucieren in den Tabak geraten, werden ebenfalls kritisch beäugt. Erst sie, und nicht (allein) der reine Tabak, seien für manche der durch die Verbrennungsprozesse entstehenden Schadstoffe und die mit ihnen verbundenen gesundheitlichen Folgen des Zigarettenrauchens verantwortlich zu machen. Sie würden auch die Attraktivität des Rauchens und damit das Suchtrisiko erhöhen (siehe dazu den Beitag von adh in diesem Heft). Einige esoterische Industrie-Kritiker gehen gar von der Unschuld des unbehandelten Tabaks und der relativen Harmlosigkeit des Nikotins aus, wittern in den in bösartiger Absicht von der skrupellosen Industrie eingesetzten Zusätzen das eigentliche Übel.

Nicht viel anders als im Falle von Koka, Opiummohn oder Rauschhanf hat die menschliche Leidenschaft für den Tabak auch ökologisch (Zerstörung noch intakter Biosysteme durch Expansion des Anbaus und Verarbeitungsprozesse, die auf Kosten der Umwelt gehen), ökonomisch (wirtschaftliche Abhängigkeiten), sowie kulturell und politisch weitreichende Folgen (siehe z.B. „BUKO Agrar Dossier 24: tabak“ oder Hengartner/Merki (Hrsg.) „Tabakfragen“). So sind der Tabak und seine Konsumenten nicht nur ins Visier von Gesundheitspolitikern, sondern auch von Ökologen und Globalisierungsgegnern (siehe www.rauchopfer.org) geraten. Die intensiv um Markterweiterung kämpfende Zigarettenindustrie sieht sich in den westlichen Ländern in der Defensive. Sie konzentriert ihre Aktivitäten zur Erschließung neuer Märkte für westliche Zigaretten durch aggressives Marketing jetzt verstärkt auf Entwicklungsländer (z.B. besonders auf Frauen und Kinder in Afrika und Asien, siehe Geist/Heller/Waluye „Rauchopfer“). Bei aller berechtigten Kritik am Gebahren der Tabaklobbyisten und dem destruktiven Konsumverhalten der Raucher, scheinen sich in dieser Debatte, insbesondere, was die Feindseligkeit und die Forderungen nach immer mehr „Rauchverboten“ betrifft, bisweilen linke und rechte Puritaner im Regulierungswahn und in lustfeindlicher Einigkeit die Hände zu reichen. Denn, was gerne vergessen wird, bei allen bedenklichen Auswirkungen, Rauchen ist immer wieder auch eine Lust, kann manchmal durchaus eine Bereicherung des Lebens sein, besonders wenn man es schafft, das Kraut nur gelegentlich zu genießen. Für viele Raucher ist es das oft selbst dann noch, wenn sie nicht vom Glimmstengel lassen können, sich also abhängig verhalten, so gesehen „süchtig“ sind.
Wären räumliche Einschränkungen des Rauchens zum Schutz von Nichtrauchern, Werbeverbote außerhalb von Fachmagazinen, Beschränkung des Verkaufs auf Fachgeschäfte, Verpflichtung zur Deklaration von Inhaltsstoffen und zweckgebundene Steuern für die Prävention bei Kindern und Jugendlichen und die Linderung der Folgen des Tabakkonsums noch nachvollziehbar, so trägt die Irrationalität, mit der die Schikane und gleichzeitige Ausnutzung der Tabakkonsumenten als Geldquelle inzwischen betrieben und wegen angeblich sinkender Konsumentenzahl als Triumph gefeiert wird, nicht nur absurde Züge, sondern führt offensichtlich zur Schaffung von Schwarzmärkten und Raucher-Subkulturen. Das Letztere ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, sitzen die Raucher doch auf diese Weise bald in einem Boot mit den Gebrauchern anderer verteufelter Genussmittel. Da besteht doch Solidarisierungspotential! Dann stehen die Kiffer hinter der Turnhalle nicht mehr allein herum, sondern können sich mit ihren quarzenden Lehrern ein Stück weit darüber unterhalten, wie sich das so anfühlt, wenn man als sozial ausgegrenzter Betroffener einem geheimen Laster frönt.
Wie heuchlerisch die Hetze gegen die Raucher ist, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Staat bei einer Einnahme von mehr als 14 Milliarden Euro allein an Tabaksteuern (für das Jahr 2003), wozu noch Umsatzsteuern, sowie indirekt obendrein die Lohnsteuern der 100.000 in Tabakverarbeitung und -handel beschäftigten Menschen kommen, den Löwenanteil (mehr als zwei Drittel) am Umsatz der dagegen geradezu bescheidenen Tabakindustrie einstreicht, ohne dafür adäquate Gegenleistungen zu bieten, während die gesundheitlichen Folgekosten des Tabakkonsums in erster Linie über Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungen von der Allgemeinheit getragen werden.
In Anbetracht der hohen Preise für Zigaretten, die in erster Linie mal wieder die Ärmsten zu Billigprodukten (Feinschnitt und Steckzigaretten) oder zum Kauf auf dem Schwarzmarkt (2004 stellte der deutsche Zoll 25 Milliarden Schmuggelzigaretten sicher) nötigen, mag man als Abhängiger in Erwägung ziehen, sein eigenes Kraut anzubauen, so wie es zuletzt in den mageren Jahren der unmittelbaren Nachkriegszeit verbreitet war. Obendrein wäre in Bezug auf die Machenschaften der Tabakindustrie eine Selbstversorgung auch noch politisch oberkorrekt. Wer seinen Tabak selbst verarbeitet, behält gewissermaßen auch die Kontrolle über das Produkt, was er am Ende konsumiert, auch wenn das dann gesundheitlich nicht unbedingt weniger fragwürdig ist. Nikotinhaltiges Blattwerk lässt sich leicht gewinnen. Der private Anbau zur Selbstversorgung und ohne Verkaufsabsicht, in der Praxis sind das in Deutschland immerhin bis zu 99 Pflanzen pro Person, ist tabaksteuerfrei. Mindestens 50 Gramm getrocknete Tabakblätter pro Pflanze können geerntet werden.

100 Gramm sind durchaus realistisch. Eine Fläche von ca. 5 mal 5 Metern würde demnach für die Produktion von 10.000 Selbstgedrehten (mit je 1 Gramm Tabakblättern) ausreichen. Das sind, aufs Jahr gerechnet, 27 kräftige Kippen pro Tag. Im von der EU hoch subventionierten professionellen Anbau wird auf dieser Fläche sogar das Doppelte geerntet. Eine ganz legale Selbstversorgung ist für den durchschnittlichen Raucher also durchaus denkbar. Schon in einer einzigen reifen Tabak-Kapsel können 1500 bis 3500 winzige hochgradig keimfähige Tabaksamen enthalten sein. Eine voll ausreifende Tabakpflanze kann bis zu 150 Kapseln bilden! Die Samen liefern übrigens auch ein wertvolles Speiseöl. Sie werden im Freiland zwischen September und November reif. Man kann sie im Fachhandel (www.tabakanbau.de) erwerben oder Bauern um ein paar Samen bitten. Die bekannteste Sorte der Wessis ist der Badische Geudertheimer. DDR-Nostalgiker mögen sich für den „Rot Front“-Korso entscheiden. Reich an aromatischen ätherischen Ölen, aber hierzulande niedrig im Ertrag sind die früher so beliebten Orient-Tabake. Eine Nikotinbombe, aber geschmacklich verrufen, ist der Bauerntabak (s.o.). Bei der Sortenwahl ist zu beachten, wofür der Tabak genutzt werden soll (für Zigaretten, Zigarrren, Wasserpfeife, Kautabak etc.). Der züchterische Trend im professionellen Anbau geht übrigens zu Sorten mit vermindertem Nikotingehalt, aber auch geringerem Teergehalt. Die Samen bleiben bei dunkler, trockener und kühler Lagerung 5 bis 10 Jahre keimfähig. Man kann sie zwar auch im Blumentopf auf dem Fensterbrett ziehen, das ist aber nicht sonderlich ertragreich. Am Besten, man sät sie ab Ende März nicht zu dicht bei >10°C, besser aber bei 20°C, als Lichtkeimer oberflächlich ohne Erdbedeckung an einem geschützten Standort (Gewächshaus) aus. Sobald die Pflanzen etwa sechs Blätter haben, werden sie vorsichtig vereinzelt. Nach den Eisheiligen kann man sie hierzulande ins Freiland bringen. Etwa 45 cm Spielraum pro Pflanze sind gut. Ein warmer lichtreicher Standort, reichlich Wasser und genügend Dünger, und der Tabak sprießt prächtig bis zu 2 Meter in die Höhe. Schließlich müssen zur besseren Blattentwicklung noch die Blüten rechtzeitig geköpft und die Seitentriebe ausgezupft, sprich gegeizt werden. Näheres findet man in der Fachliteratur für den wiedererwachenden Tabakselbstanbau (Barth/Jehle „Tabakanbau und Tabakverarbeitung leicht gemacht“).
Schwieriger ist es da schon, den richtigen Erntezeitpunkt für die Blätter zu ermitteln, während sie an der Pflanze von unten nach oben aufsteigend dabei sind, sich in Richtung gelb oder erbsgrün zu entfärben. Noch komplizierter wird es beim langsamen Trocknen. Das Tabakblatt enthält zwar in jedem Falle mehr oder weniger Nikotin, entlockt den meisten Knarzern aber pur geraucht vor allem Hustenanfälle, denn erst durch das gekonnte Trocknen, Fermentieren, Soßieren mit Geschmack gebenden und die Brenneigenschaften beeinflussenden Zutaten und Mischen verschiedener Tabaksorten wird aus dem rohen Tabak ein aromatisches Genussmittel. Hier ist also enthusiastisches Tüfteln und Experimentieren des engagierten Hobbybauern oder eine Abkehr vom gewohnten Verwöhnaroma hin zum urtümlichen Rachenkratzer die Alternative. Wann sich gar der Guerilla-Anbau für den durchschnittlichen deutschen Lullenlutscher-Sargnagelschmaucher tatsächlich zu lohnen anfängt, steht allerdings noch in den Sternen. Bei aller Begeisterung für diese schöne und erstaunliche Pflanze, knuffige Grow-Magazine für den Underground-Kleinbauern Marke „Tabakblatt“ gibt es noch nicht am Zeitungskiosk. Auch Vereine, wie „Tabak als Medizin“ und „Tabak rettet die Welt“ („e.V.“) lassen noch auf sich warten. Aber wie lange noch?!
az










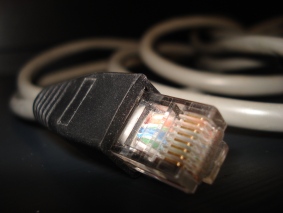
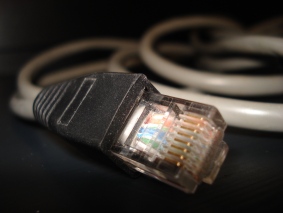



 Sein nie versiegender Zorn wird zusätzlich von dem Glauben gespeist, dass es nach den Morden an Kennedy, Martin Luther King und Malcolm X keine Versöhnung mit Amerika mehr geben kann. Thompson trägt den amerikanischen Traum seit nunmehr dreißig Jahren zu Grabe. Dazu gehört sein Hass auf die Präsidenten, heißen sie nun Nixon, Ford, Reagan, Clinton (in dessen Beraterstab er kurz saß) oder jetzt wieder Bush. In Pamphleten für den Rolling Stone kriegen alle ihr Fett weg. Lange vor Michael Moore attestierte Thompson den USA eine verlogene Politik, eine korrupte Wirtschaft und eine nur auf Konsum geeichte Gesellschaft. Die mit dem System verbandelten Medien und den Journalismus hält er dabei für eine blinde Gasse zur Kehrseite des Lebens, ein dreckiges, nach Pisse stinkendes kleines Loch, auf Anordnung eines Bauamt-Inspektors zugenagelt, aber noch groß genug für einen Wermutbruder, sich in einer Nische am Gehsteig zu verkriechen und sich einen runterzuholen wie ein Schimpanse im Zookäfig.
Sein nie versiegender Zorn wird zusätzlich von dem Glauben gespeist, dass es nach den Morden an Kennedy, Martin Luther King und Malcolm X keine Versöhnung mit Amerika mehr geben kann. Thompson trägt den amerikanischen Traum seit nunmehr dreißig Jahren zu Grabe. Dazu gehört sein Hass auf die Präsidenten, heißen sie nun Nixon, Ford, Reagan, Clinton (in dessen Beraterstab er kurz saß) oder jetzt wieder Bush. In Pamphleten für den Rolling Stone kriegen alle ihr Fett weg. Lange vor Michael Moore attestierte Thompson den USA eine verlogene Politik, eine korrupte Wirtschaft und eine nur auf Konsum geeichte Gesellschaft. Die mit dem System verbandelten Medien und den Journalismus hält er dabei für eine blinde Gasse zur Kehrseite des Lebens, ein dreckiges, nach Pisse stinkendes kleines Loch, auf Anordnung eines Bauamt-Inspektors zugenagelt, aber noch groß genug für einen Wermutbruder, sich in einer Nische am Gehsteig zu verkriechen und sich einen runterzuholen wie ein Schimpanse im Zookäfig.
