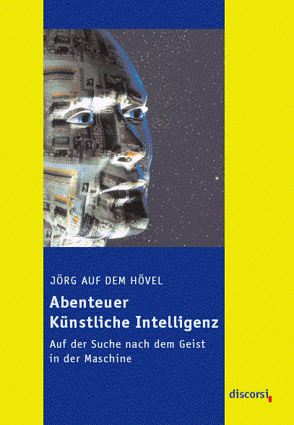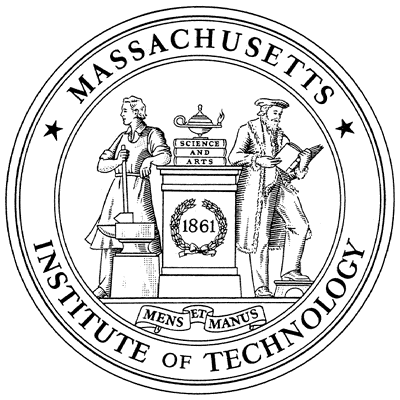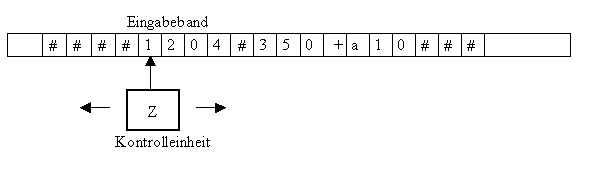Das Essen der Zukunft
Das Geschäft mit Lebensmitteln mit einem beworbenen Zusatzwert boomt. Joghurts mit Bakterienkulturen, cholersterinsenkende Margarinen, ACE-Fruchsäfte, jodiertes Speisesalz. Die Regale in den Supermärkten sind voll mit Nahrung, denen gesundheitsfördernde Substanzen beigemengt wurden. Der Markt wird weiter wachsen, schon in 2005 lag das Umsatzwachstum bei probiotischen Joghurts bei knapp 17 Prozent, im ersten Halbjahr 2006 bei über 12 Prozent. Weltweit werden jährlich rund 590 Millionen Euro für diese Milchmixprodukte ausgegeben.
Für die USA prognostiziert das Natural Marketing Institute (NMI) weiterhin riesige Wachstumsraten. Bis 2009 sollen im Sektor der funktionalen und ergänzten Nahrungsmittel jährlich knapp 60 Milliarden US-Dollar umgesetzt werden, Food-Design Experten wie Elizabeth Sloan propagieren den ungebrochenen Trend.
Noch ist der Anteil von „functional food“ an der täglichen Nahrung bei uns gering, er liegt bei unter drei Prozent. Heiko Dunstmann, Nahrungsergänzungsmittel-Experte an der Universität Weihenstephan, erwartet bis 2011 allerdings eine Verdoppelung. Beim Unilever-Konzern denkt man größer. Weil das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung weiter steige, würden auch Mehrwert-Produkte eine immer größere Bedeutung erlangen. Parallel dazu, so nimmt man an, stehe der Konsument künftig noch mehr in Eigenverantwortung für seine Gesundheit. Der Sprecher des Unternehmens, Rüdiger Ziegler, sagt: „Wir erwarten, dass der Anteil an functional food bis 2010 auf einen spürbaren Anteil vom weltweiten Lebensmittelmarkt wachsen wird.“
Die Industrie lebt vom Schaffen neuer Bedürfnisse, im sensiblen Bereich der Fütterung einer bewegungsarmen Gesellschaft gelingt dies besonders gut. Das Marktforschungsunternehmen ACNielsen hat gerade durch eine Umfrage herausgestellt, dass schon heute über 41 Prozent der Deutschen dem Satz zustimmen: „Lebensmittel mit gesundheitsförderndem Zusatznutzen halte ich für eine gute Sache“. Dabei ist die positive Wirkung der frisierten Speisen umstritten, mehr noch, von manchen Zusatzstoffen gehen gesundheitliche Risiken aus. Und: Die designte Nahrung ist eine weitere Etappe auf dem Weg zur völligen Denaturierung menschlicher Kost.
„Aus Sch… Geld zu machen“
Die wohl bekannteste Funktionsspeise auf dem deutschen Markt ist der probiotische Joghurt. Nestle („LC1“), Danone („Actimel“), Müller Milch („ProCult“) und mittlerweile auch die Discounter-Märkte bieten Joghurts an, die mit Bakterienstämmen ergänzt wurden. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, jeweils genau definierte, gezüchtete Stämme. Die Theorie: Diese Mikroorganismen sollen sich im Darm ansiedeln, das Immunsystem stimulieren und für eine bessere Verdauung sorgen. In der perestaltischen Praxis ist unsicher, wie viele der neuen Helfer tatsächlich im Darm ankommen.
Die Zeitschrift „Ökotest“ stellte bereits 1999 viel niedrigere Konzentrationen in Joghurts fest. Zudem überlebten nur zehn bis maximal 40 Prozent der Keime den Weg durch Magen und Galle, der größere Teil kam also gar nicht an.
Sind die probiotischen Joghurts also nur ein Marketing-Gag? Die Hersteller halten mit Expertisen dagegen. Im Nestle-Labor bei Lausanne hat man Jahre lang unterschiedlichste Bakterienarten überprüft und sich schließlich für die Sorte „Lactobacillus acidophilus“ entschieden. Eine Milchsäurebakterie, die im Darm heimisch ist und in dem Ruf steht das Immunsystem zu stärken.
Sie wurde von den Forschern ursprünglich aus menschlichen Fäkalien gewonnen wurde, ein Umstand, der den Lebensmittel-Experten Udo Pollmer („Lexikon der Ernährungsirrtümer) 1999 zu der Aussage brachte: „Womit es der Lebensmittelwirtschaft tatsächlich gelungen ist, aus Sch… Geld zu machen.“ Ob einige der aktuellen Keime noch immer aus Kot oder Vaginalabstrichen stammen oder künstlich hergestellt werden, vermag Pollmer heute nicht zu sagen, „auch wenn es naheliegen mag.“
Milchsäurebakterien wurden schon immer genutzt, um Joghurt herzustellen. Die heute zugefügten probiotischen Mikroben gehören verschiedenen Stämmen an, die Herstellern setzen auf eigene Entdeckungen, um dem „Innovationsprodukt 1995“ LC1 Marktanteile streitig zu machen. Müller arbeitet mit dem Bifidobakterium „longum BB 536“, die Firma Yakult mit dem „lactobacillus casei shirota“.
Noch fehlen Studien über die Langzeitwirkung, aber Nestle konnte nachweisen, dass beim tägliche Verzehr eines LC1-Joghurts über mehrere Wochen hinweg der Anteil dieser Bakterien um das Zehnfache wächst. Dadurch, so zeigten voneinander unabhängige Studien, können Durchfälle, die durch Rotaviren oder nach Antibiotikatherapie auftreten, kürzer dauern und seltener auftreten.
Lohnt der Kauf der teureren Produkte also? Ansichtssache: Schon der konventionelle Joghurt reduzierte die Dauer von Diarrhöen von 8 auf 5 Tage, der probiotische auf 4 Tage. (1)
Dauereinsatz
Mittlerweile hat sich die Erforschung der Probiotika auf Erkältungen ausgedehnt. Auch bei Infektionen der oberen Atemwege scheinen Probiotika positive Effekte zu zeigen. In einer Doppelblindstudie verkürzte die Anwendung eines probiotischen Keimgemisches die Erkältungsdauer um knapp zwei Tage, auch die Symptomatik wurde reduziert.(2)
Aber: Um den immunsteigernden Effekt der Mikroorganismen aufrechtzuerhalten ist eine dauerhafte Zufuhr nötig. Noch ist unklar, wie lange die probiotischen Keime im Darm überleben und welche Dosen für eine eventuelle Kolonisierung nötig sind. Um überhaupt einen Einfluss auf die Darmflora ausüben zu können müssen wahrscheinlich täglich 108 (10 hoch 8) quicklebendige Zellen aufgenommen werden. Das probiotische Lebensmittel muss also mindestens 106 (10 hoch 6) solcher Zellen pro Gramm oder Milliliter enthalten, wenn die erforderliche Bakterienmenge mit üblichen Verzehrsmengen verpeist werden soll. Und noch ein Problem stellt sich: Schon nach ein paar Tagen ohne probiotischen Joghurt normalisieren sich die hohen Werte an gesunden Bakterien wieder.
Sind damit auch die Gefahren ausgeschlossen? Zumindest sind Probiotika bei hoher Dosierung nicht ungefährlich. Zumindest die Hersteller von Probiotika-Kapseln müssen auf ihren Beipackzetteln vor möglichen Risiken warnen, denn bei Menschen mit empfindlicher Bauchspeicheldrüse, Galle und Leber sind Komplikationen möglich. (3)
Noch weitgehend unbekannt sind Wirkmechanismus und Pharmakokinetik der Probiotika. Udo Pollmer sieht den Hype um die Bio-Kulturen kritisch: „Die Versuche, die Darmflora gezielt zu verändern, muten etwas seltsam an, wenn man bedenkt, daß deren genaue Zusammensetzung immer noch unbekannt ist.“ Eine generelle positive Bewertung von Probiotika ließe sich nicht vornehmen, die Effekte seien immer nur für einen oder wenige Bakterienstämme nachgewiesen.
Jürgen Schrezenmeir von der Bundesanstalt für Ernährung und Lebensmittel in Kiel beurteilt die Datenlage insgesamt dagegen als so überzeugend, daß er zu einer präventiven Einnahme von Probiotika rät: „Es spricht vieles für eine Empfehlung“, erklärte Schrezenmeir 2005, allerdings bei einer Veranstaltung des „Instituts Danone für Ernährung“ in Stuttgart.
So kompliziert wie möglich
Den nächsten Schritt Richtung weitgehender Denaturierung der Nahrung ging 2004 Benno Kunz an der Universität Bonn. Er und sein Team von Lebensmitteltechnologen verpackten Milchsäurebakterien in sogenannte Mikrokapseln. Darüber gelangen die Probiotika unbeschadet durch die Magensäure hindurch in den Darm, wo sie ihre Wirkung entfalten können. Mit der Erfindung können künftig auch andere Produkte mit Probiotika aufgepeppt werden, zum Beispiel Wurst oder Gummibärchen. Im baden-württembergischen Ellwangen steht beim Chemieunternehmen Rettenmaier & Söhne bereits eine Produktionsanlage, die das Verfahren zur Herstellung von mikroverkapselten „Lactobacillus reuteri“-Bakterien nutzt.
Die Diskussion um die probiotischen Zusätze lässt sich auf andere Substanzen übertragen, die ihren Weg vermehrt in die Lebensmittel finden. Die Idee, Nahrung pharmazeutisch aufzupeppen, ist zwar nicht neu, wurde aber in den letzten Jahren perfektioniert. Bis vor zehn Jahren ging es noch um einzelne Anreicherungen, beispielsweise reicherte man Orangensaft mit Calcium an. Heute landen eine Vielzahl von Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien in allmöglichen Produkten. In den USA gibt es inzwischen kaum mehr ein industriell verarbeitetes Nahrungsmittel ohne diese „Zusätze“.
Für die industriell ausgefeilte Nahrungsmittelindustrie wird die unbehandelte Kartoffel vom Feld immer mehr zum Greuel, suggeriert sie doch, dass man auch ohne Zusatzstoffe gesund und preiswert leben kann. Aber genau dies ist möglich, nur wird es von den Apologeten der funktionellen Ernährung gerne verschwiegen. „Gute Nahrung“ muss für sie möglichst lange chemischen Prozessketten durchlaufen, nur dann wirkt sie „optimal“.
Soylent Green?
Damit stehen sie in zwei althergebrachten Traditionslinien, die zunehmend kritisch gesehen werden. Zum einen in der Tradition den Menschen als Maschine anzusehen, der nur etwas eingeworfen werden muss, um eine beliebige Funktion in Gang zu setzen. Zum anderen in der Tradition einer industrialisierten, pestizidkonformen Landwirtschaft, die in dem Ruf steht, die Grundlage ihrer Produkte, die Natur, durch unbedachten Umgang zu zerstören und zudem Nutztiere unter zumindest seltsamen, oft aber auch einfach erschreckenden Bedingungen hält. Selbst glückliche Bio-Kühe auf grünen Almen werden in kurzen Abständen neu geschwängert, um Milch zu geben.
Überzeichnet dargestellt sorgt eine hochtechnisierte Weiterverarbeitung in den Fabriken dafür, jeden verbliebenen, naturnahen Inhaltsstoff aus Milch, Frucht und Gemüse herauszuprügeln, um ein gleichförmiges Einheitsprodukt zu garantieren. Während in Halle 1 das Gut durch mechanische Behandlung und chemische Bäder gereinigt, separiert und purifiziert wird, soll in Halle 2 dem entleerten Produkt wieder eine Seele eingehaucht werden, indem allerlei Substanzen beigefügt werden.
Mancher Erdbeerjoghurt hat nur den Bruchteil einer Erdbeere gesehen und erhält seinen Geschmack durch australische Holzspäne und seine Konsistenz durch Emulgatoren. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Hinter allem steht der von Industrie und vielen Verbrauchern gleichermaßen getragene Irrglaube, man könne Nahrungsmittel immer billiger herstellen, ohne das sie dabei an Güte zu verlieren. Aber in die Einsicht dieses sauren Apfel will kaum einer beißen.
So wird es bei dem Trend bleiben „unser täglich Brot“ als Optimierungsspielwiese zu betrachten, um ungeahnte Konsumentenwünsche zu erzeugen. Pillenaffinität und Wissenschaftsgläubigkeit geben den Weg zur Durchdringung der alltäglichen Lebensmittel mit Zusätzen frei. Mit der Gesundheitsangaben-Verordnung der EU (siehe „Wucht und Wahrheit in Tüten„) ist es einem Hersteller bald erlaubt darauf hinzuweisen, dass sein Lebensmittel das Risiko an einem bestimmten Gebrechen zu erkranken senkt. Die Unterschiede werden fein: Es bleibt dem Hersteller weiterhin verboten, sein Produkt als Heilmittel von Krankheiten zu bewerben.
Zutat oder Marginalie?
Für das „functional food“ wird das eine neue Zeit einläuten. Ein durch EU-Experten bestätigter, gesundheitlicher Zusatznutzen, der offen beworben werden kann, wird Heerschaaren von Wissenschaftler im Auftrag der Konzerne auf die Suche nach immer neuen Lebensmittelzusätzen gehen lassen, die möglicherweise das Risiko senken, zu einer bestimmten Krankheit zu erkranken. Vorbild für die EU sind die Regularien der amerikanischen FDA (Food and Drug Administration). In den USA wird die Liste mit den angeblich gesunden Inhaltsergänzungsstoffen immer länger.
Angelika Michel-Drees vom Verbraucherzentrale Bundesverband ist daher besorgt, dass zukünftig Lebensmittel mit einem ungünstigen Nährstoffprofil zu functional food und somit als gesund ausgelobt werden können. „Süßigkeiten, Knabberartikel und zuckerhaltige Getränke sollten beispielsweise nicht durch Anreicherung und entsprechender Auslobung ein gesundes Image verliehen werden können.“ Die angereicherte Produkte würden auch „nicht automatisch gesünder machen“, so Michel-Drees, „denn sie können möglicherweise eher Ernährungsfehlverhalten und sonstige falsche Lebensgewohnheiten noch fördern.“
Neben den Probiotika sind es vor allem Vitamine, die Produkten beigemengt werden. Sie werden von Pharma-Konzernen wie BASF und DSM hergestellt und vertrieben. Der beliebte ACE-Vitaminmischung landet in Fruchsäften. In Deutschland hat das Bundesinstitut für Risikobewertung zwei Publikationen herausgegeben, in denen die toxikologischen und ernährungsphysiologischen Aspekte der Verwendung von Vitaminen und Mineralstoffen in Lebensmitteln erläutert werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sieht den chemischen Zauber nicht gerne, ihr Fazit: Wer sich vernünftig ernährt (und natürlich an die Richtlinien der DGE hält) braucht nur in Ausnahmezeiten wie der Schwangerschaft eine Extra-Portion irgendwelcher Vitamine.
Gehen Nahrungsergänzungsmittel und „functional food“ also weithin am tatsächlichen Bedürfnis der Menschen vorbei und tragen eher zur degenerierten Esskultur bei anstatt sie zu verbessern? Einige Ernährungsexperten äußern die Vermutung, dass die angereicherte Nahrung ohnehin nur der Gewissensberuhigung dienen. Mit einem probiotischen Joghurt pro Tag und ein paar Vitaminpillen würde versucht, den ansonsten ungesunden Lebenswandel wett zu machen. Dabei ist die Lösung aus dem Dilemma von schlechter Ernährung und Verfettung vergleichsweise einfach: Regelmäßige Bewegung und naturnahe Produkte, maßvoll genossen. Und am Ende der Diskussion um Probiotika und andere Zusätze in „funktionellen“ Lebensmitteln stellt sich heikle Frage: Wenn mit solchen Zutaten tatsächlich Krankheiten behandelt werden können, handelt es sich dann nicht doch um Medikamente?
— — —
Endnoten:
(1) Ärzte Zeitung v. 30.08.2005.
(2) M. de Vrese u.a. (2005): Effect of Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium longum SP 07/3, B. bifidum MF 20/5 on common cold episodes: a double blind, randomized, controlled trial, in: Clinical Nutrition, Nr. 24, S. 481-491.
(3) Catanzaro, J.A.; L. Green (1997): Microbial ecology and probiotics in human medicine (part II). Alt. Med. Rev. 2: S. 296-305.