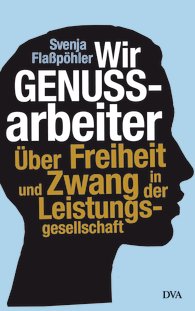„Wir kommen um die Systemfrage nicht herum“
Interview mit Svenja Flaßpöhler über Leistungsdruck und Selbstverwirklichung in der postindustriellen Arbeitsgesellschaft
Arbeit und Genuss sind für eine Vielzahl von Menschen in der westlichen Hemisphäre nah zusammengerückt. Gerade die durch die Informationsarchitekturen beschleunigte Mittelschicht der Gesellschaft neigt zu exzessivem Arbeitsverhalten, es herrscht zwanghaftes Tun. Aktivität und Leistung sind selbst in der Freizeit die bestimmenden Antriebskräfte. Der Geist des Kapitalismus, der sich aus Sicht von Max Weber noch aus der protestantischen Ethik speiste, erfährt dabei eine neue Ausformung: Heute arbeitet man nicht mehr für Gott, sondern zur Erhöhung des Selbstwerts. Die Philosophin Svenja Flaßpöhler analysiert die Ursachen und Symptome dieses Phänomen unter dem Stichwort „Genussarbeit“.
Als ich Sie per Email um das Interview bat, haben Sie erst nach knapp vier Wochen geantwortet. Genussarbeit oder falsches Zeitmanagement?
Svenja Flaßpöhler: Das war ausnahmsweise einmal richtiges Zeitmanagement. Ich hatte nämlich schlichtweg keine Zeit, aufgrund meiner neuen Arbeit als stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie Magazins. Auf diese Arbeit wollte – und musste – ich mich konzentrieren. Genussarbeit in einem positiven Sinne heißt für mich genau das: Muße, Raum und Ruhe haben, um sich der Arbeit lustvoll zu widmen und trotzdem noch die anderen Dimensionen des Lebens zu leben. Genussarbeit in einem schlechten Sinne besteht aus exzessiver, zwanghafter, ausschließlicher Beschäftigung. Der exzessive Genussarbeiter kann nicht loslassen, nicht ablassen, nicht auslassen, nicht seinlassen. Hätte ich Ihre Mail also gestresst und womöglich nachts beantwortet, wäre genau das der Fall gewesen. Insofern schließen sich Genussarbeit und falsches Zeitmanagement übrigens nicht aus.
Ihr Genussarbeiter definiert seinen Selbstwert vor allem über die Arbeit und macht sich dadurch abhängig von der Anerkennung durch Kollegen und Vorgesetzten. Brauchen wir die Bestätigung unseres Tuns aber nicht alle? Und wie stellt man fest, ab wann die Grenze zum Krankhaften überschritten ist?
Svenja Flaßpöhler: Davon bin ich tatsächlich fest überzeugt: Niemand tut etwas einfach nur aus sich selbst heraus, sondern immer auch für einen Anderen. Das lässt sich an Kindern wunderbar beobachten. So selbstvergessen sie beispielsweise ein Bild malen: Es ist wichtig, dass Mama oder Papa das Bild würdigen. Wenn die Eltern vollkommen gleichgültig und gefühlskalt wären, würde das Kind möglicherweise überhaupt nicht malen. Dieses Angewiesensein auf die Anerkennung Anderer ist die Grundstruktur des menschlichen Schaffens, ja Existierens schlechthin. Schlimm wird es allerdings, wenn der Blick ausschließlich auf die Anderen und deren unter Umständen gnadenloses Urteil gerichtet wird. Dann stellt sich schnell das Gefühl ein, nie genügen zu können, und der individuelle Antrieb des Arbeitens geht verloren. Was zählt, ist nur noch der Erfolg, eine sinnentleerte, abstrakte Anerkennung, die schal ist. Der Kampf in Anerkennung schlägt in Sucht nach Anerkennung um.
Wir halten Passivität kaum mehr aus
Ein Problem dabei scheint zu sein, dass egal, was der Einzelne leistet, er durch viele äußere und innere Faktoren zu immer mehr angespornt wird.
Svenja Flaßpöhler: Ansporn ist zunächst einmal etwas Positives: Was wäre das Leben ohne diesen leichten Schmerz, diese Grundspannung, die uns auf Trab hält? Wem der Ansporn voll und ganz verloren geht, ist depressiv. Das Problem ist aber, dass das Angesporntsein heute absolut gesetzt wird: Das Ideal ist der ständig angespornte Mensch, der unablässig neue Ideen produziert, in seinem Beruf „aufgeht“, wie es so schön heißt und auch im Urlaub das Smartphone ganz nah am Herzen trägt. Aber Aktivität braucht Passivität als entgegengesetzten Pol. Keine Motivation ohne Langeweile, keine Inspiration ohne Phasen des Nichtstuns. Mein Eindruck ist, dass wir Passivität kaum noch aushalten.
Kann man sagen, dass das System diejenigen nach unten durchreicht, die dieses hyperaktive Spiel nicht mitmachen können – oder wollen?
Svenja Flaßpöhler: Einerseits ja. Wer sonntags prinzipiell nicht arbeitet und wochentags nach Feierabend keine Emails mehr checkt, gilt schnell als unbrauchbar. Allerdings, und insofern stimmt Ihre Annahme nur eingeschränkt, landen in der Regel ja auch die „unten“, die das Spiel mitmachen. Hyperaktivität schützt vor sozialem Abstieg keineswegs. Irrtümlicherweise glauben wir, uns durch ständige Präsenz unentbehrlich zu machen. Aber Präsenz ist keine individuelle, das heißt unaustauschbare Eigenschaft. Es gibt immer jemanden, der noch präsenter ist. Insofern sollten wir, da das Spiel nicht gewonnen werden kann und auch nicht glücklich macht, den Mut haben zu sagen: I would prefer not to.
Und wo liegt die Grenze zur Faulheit, die ohne soziale Verantwortung agiert?
Svenja Flaßpöhler: Ich würde den Spieß gern umdrehen. Ein hyperaktiver Mensch, der immer nur nach vorne, nie aber nach links und rechts, geschweige denn nach hinten schaut, weil er dafür gar keine Zeit hat, agiert ohne soziale Verantwortung. Ihn interessiert nur das Vorwärtskommen. Jede Ablenkung verursacht Stress.
Der faule Mensch, der Sonntags nachmittags auf dem Sofa liegt, schläft, ein bisschen Zeitung liest, zwischendurch auf der Gitarre klimpert, agiert hingegen sozial. Durch seine Passivität, die ja nie reine Passivität ist; die gibt es nur im Tod, wird er wieder offen für die Welt. Hyperaktivität verhärtet den Menschen. Passivität lässt ihn weich werden, empfindsam für Eindrücke, Verlockungen, Kinderfragen.
Wobei neue Eindrücke doch wiederum ständig um die Aufmerksamkeit buhlen. Heutzutage scheint mir selbst die Passivität von Disziplin begleitet sein zu müssen, um nicht Gefahr zu laufen, zwischen Gitarre, Zeitung, Kind und iPad hin und her zu pendeln. Die moderne Unterhaltungsindustrie setzt ja mittlerweile den Second Screen voraus, möchte also, dass wir die im Fernsehen laufenden Ereignisse und Nichtigkeiten parallel mit dem Smart Phone kommentieren.
Svenja Flaßpöhler: Das ist richtig. Und die Frage, die sich da aufdrängt, lautet: Wer beherrscht wen? Ich die Maschine oder die Maschine mich? Ich habe mir gerade ein Smartphone angeschafft und laufe ständig Gefahr, dem Gerät erlegen zu sein. Die Faszination, die davon ausgeht, mit dem Zeigefinger die Welt zu bewegen, ist enorm. Das Fatale ist doch, dass wir uns im Grunde gern den Maschinen unterwerfen. Lust dabei empfinden. Wir müssen heute nicht mehr Pferdekarren über Äcker schieben, sondern sitzen auf ergodynamischen Stühlen vor schicken Macs und geben uns dem Rausch der Arbeit hin. Der moderne, technisch hochgerüstete Leistungsträger genießt sein Tätigsein, fühlt sich wichtig mit dem iPhone in der Hose. Warum also soll er nach Feierabend aufhören, das Display zu liebkosen? Um der Aktivitätsfalle zu entkommen, müssen wir das Begehren identifizieren, das uns in sie hineintreibt.
Das flüssige Selbst des modernen Menschen westlicher Industrie- und Informationsgesellschaften hat enorme Probleme der Grenzziehung, ständig wird sich neu erfunden, außer dem Therapeuten sagt uns keiner mehr, wann genug ist. Wie könnten, abseits der bewussten Passivität auf individueller Ebene, Anfänge vom Ende der Beschleunigung aussehen?
Svenja Flaßpöhler: Ich bin mir sicher: Wir kommen um die Systemfrage nicht herum. Wer nur empfiehlt, ab und zu mal das iPhone auszuschalten, betreibt Symptombehandlung, und die geht bekanntermaßen nicht sehr tief. Selbstverwirklichung, für mich immer noch eine lohnenswerte Utopie, setzt die Anerkennung der eigenen Grenzen, das Wissen um die eigenen Neigungen voraus: Ohne Selbst keine Selbstverwirklichung. In Zeiten neoliberaler Flexibilisierung sind wir davon weit entfernt. Marx war der Ansicht, dass Selbstverwirklichung im Kapitalismus nicht realisiert werden kann, weil das Arbeitsprodukt nie dem Arbeiter, sondern einem Anderen gehört. Dieser Andere treibt uns an mit dem Versprechen, dass die Mühe sich lohne. Aber lohnt sie sich wirklich? Möglich, dass wir gerade dabei sind, uns auf grandiose Weise selbst zu verfehlen.
Dieses System ist nicht die beste aller möglichen Welten
Zumal auch die neuen Medien, unter der Preisgabe der Privatsphäre, die Handlungs- und Beziehungsmuster der Nutzer mittlerweile im Sinne der Logik der globalen Verwertungsmaschinerie verändern. Welche Rolle spielt die Genusskultur aus ihrer Sicht in dieser Hinsicht? Für was steht das exzessive Genießen?
Svenja Flaßpöhler: Wer exzessiv genießt, überschreitet zwanghaft Grenzen. Körpergrenzen, Schmerzgrenzen, Grenzen der Privatsphäre, moralische Grenzen. Diese Form des Genießens wird uns durch unsere heutige Kultur nachgerade aufgedrängt, indem sie die Überschreitung einerseits untersagt und gleichzeitig anpreist. Auf der einen Seite sollen wir moralisch integer, fürsorglich uns selbst und anderen gegenüber, leistungsstark, schlank und vieles anderes sein; auf der anderen Seite aber leben wir in einer Kultur der All-you-can-eat-Angebote, der Flatrates, des Internetshoppings, der ständigen Erreichbarkeit und frei verfügbarer Internetpornographie.
Unsere Konsumgesellschaft fördert zwanghaftes Genießen, weil sie einerseits auf strengstem Verzicht beruht, gleichzeitig aber durch ihre Reize die Lust an der Überschreitung provoziert. Wenn ich beim Gehen Emails checke, meinem Gesprächspartner kaum zuhöre, weil es wieder einmal piept in der Tasche, dann fühle ich durchaus – ganz subtil, als leisen Kitzel – in meinem Inneren, dass ich eine Grenze, die Grenze des Anstands, die Grenze meines Aufnahmevermögens überschreite; aber gerade in der Überschreitung liegt ja die Lust.
Das klingt so, als ob durch korrekt angewandte Passivität zugleich der systemimmanente Leistungsdruck ausgehebelt und der Konsumterror abgemildert werden könnte. Das löst noch nicht das oben aufgeworfene Problem, dass die Produkte unserer Tätigkeit selten uns selbst, sondern einem Anderen gehören.
Svenja Flaßpöhler: Der Kapitalismus funktioniert doch nur so lange, wie der oder die Einzelne mitmacht bei dem Dreischritt: Produzieren – Konsumieren – Sterben. Würde er oder sie mehr seinlassen, auslassen und weglassen, bliebe die Shoppingmall am Samstag möglicherweise leer und das Büro auch.
Ich möchte mein Plädoyer für das Lassen tatsächlich nicht nur als ein Aufruf zum Nickerchen am Sonntagnachmittag verstanden wissen, sondern durchaus auch im Sinne des Streiks: Dieses System, in dem wir vor allem damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen und Geld auszugeben, ist nicht die beste aller möglichen Welten. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass der Andere früher oder später sein Köfferchen packen muss, wenn sich die 99 Prozent zu korrekt angewandter Passivität entscheiden.