Faserhanf (Cannabis sativa) wurde früher gelegentlich auf dem Lande, wie zahlreiche andere Kräuter auch, als Tabakersatz geraucht. Heinrich Marzell listet allein 40 hierfür genutzte Pflanzenarten in seinem „Neues illustriertes Kräuterbuch“ (1920/1935) auf. Dabei erwähnt er nicht einmal definitiv psychoaktive medizinische „Asthma-Kräuter“ wie den Stechapfel, an dessen gelegentlichem hedonistischen Gebrauch sich bis in die 1970er Jahre eine kleine experimentierfreudige Anhängerschaft erfreute, die sich entsprechende Zigaretten aus der Apotheke besorgte. Unter den „Asthma-Kräutern“ fand sich (bis zum Opiumgesetz von 1929) neben Tollkirsche, Bilsenkraut, Lobelie, Tee und Opium auch der tatsächlich psychoaktive aus Indien (und später von Sansibar) importierte „Indische Hanf“ (Cannabis indica, Wolfgang Siegel „Das Asthma“, 1912).
Kategorie: Hanf

In Berlin-Kreuzberg zeigen sich die Widersprüche der Drogenpolitik. Mutigere Schritte sind nötig.
In Berlin-Kreuzberg hat sich seit Längerem in und rund um den Görlitzer Park eine offene Dealer-Szene angesiedelt. Diese und der damit zusammenhängende Kundenverkehr werden von Polizei, Anwohnern und Gästen des Parks als Problem angesehen. Die Zahlen: Bis Ende Oktober 2014 führte die Polizei sage und schreibe 350 Razzien durch, es wurden über 2.200 Personen kontrolliert, rund 1.000 Platzverweise ausgesprochen, 200 Festnahmen durchgeführt, 800 Ermittlungsverfahren angestoßen – die Hälfte davon waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Als die Bayern auszogen den Weltmarkt mit Haschisch zu überfluten
Eine wahre Geschichte
Es begab sich einst im Jahre 1925, daß die Versuchsstation für technischen und offizinellen Pflanzenbau GmbH Happing bei Rosenheim in Oberbayern (wo sonst?) in der Fachzeitschrift „Heil- und Gewürzpflanzen“ (VIII. Bd., S. 73-82) vollmundig verkündete: Cannabis indica kann „in Deutschland überall, wo guter Weizen gedeiht, mit Erfolg gebaut werden. Unser Anbau ist längst aus dem Versuchstadium herausgekommen und zum Anbau im Großen geworden. In den letzten Jahren lieferten wir dem deutschen Großdrogenhandel 3000 Kilo und sagen deshalb…für Cannabis indica: Das englische Welthandelsmonopol wird in Kurzem der Geschichte angehören. Voraussetzung ist der Anbau einer hochwertigen, akklimatisierten Saat. Daß von uns nach den acht Jahren Auslese und Dutzenden von Analysen die Hochhaltung im Auge behalten wird, ist selbstverständlich. Im Herbste werden wir an Interessenten Samen abgeben können.“
Diese glückverheissenden Zukunftsperspektiven konnten natürlich in der etablierten Fachwelt nicht unwidersprochen bleiben. Schon damals waren die medizinischen Wirkungen des Indischen Hanfes und seiner psychoaktiven Zubereitungen, die man ganz allgemein unter dem schwammig verwendeten Begriff Haschisch zusammenfasste, umstritten. Die praktische Anwendung beschränkte sich auf einige wenige Präparate. Die Firma „Fresenius“ in Frankfurt am Main stellte beispielsweise eine Kombination des Barbiturat-Schlafmittels „Veronal“ mit dem Extrakt des Indischen Hanfes her, das „Indonal“. Diese die notwendige Dosis und die unerwünschten Nebenwirkungen des Veronals angeblich senkende Kombination fand ihren Fürsprecher in einem Wissenschaftler namens Emil Bürgi (Dtsch. Med. Wschr. 7.11.1924), vielleicht einem Ahnen des bekannten Lochfraß-Experten der Gegenwart. Vor allem landete aber der Großteil des produzierten Hanfextraktes in Deutschland als Zusatz in Einpinselungen und Pflastern auf Salicylkollodium-Basis zur Entfernung von Hühneraugen, einem Leiden über das heutzutage nur noch hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird und das auch nicht durch engagierte Hühneraugenstiftungen oder Benefiz-Veranstaltungen vom Typ Life-Hühneraugen-Ball von sich Reden macht. Dr. Th Sabalitschka aus Berlin, der die Happinger Anbauversuche kontrollierte und die Ergebnisse publizierte, bemühte sich aber an weitere zurückliegende therapeutische Anwendungen zu erinnern. Die bereits erfolgreiche Verwendung von Cannabis bei Starrkrampf, bei Lyssa, Cholera, chronischen Rheumatismen, Delirium tremens, Husten, Strychninvergiftung und als wehenförderndes Mittel sei wissenschaftlich zu überprüfen. Es bestünde „in der Therapie für Cannabis eine vielseitige Anwendungsmöglichkeit, die aber erst richtig ausgenutzt werden kann, wenn Drogen und Präparate von bekannter und sicherer Wirksamkeit zur Verfügung stehen.“ Die Bewertung des medizinisch einzusetzenden Hanfkrautes war damals allerdings schwierig, da man die wirksamen Inhaltsstoffe noch nicht kannte. Man wußte lediglich, daß es sich bei den psychoaktiven Wirkstoffen um harzige Bestandteile handeln mußte.
Dieser Einschätzung der medizinischen Möglichkeiten widersprach Dr. Ernst Joel vom Gesundheitsamt des Bezirks Berlin-Tiergarten aufs Heftigste (Klin. Wschr. 26.2.1926). Alle genannten Indikationen seien praktisch obsolet. Er formulierte eine klassische Position der Rauschhanf-Prohibitionisten: „Wir sehen im indischen Hanf kein aussichtsreiches Heilmittel, sondern ein Rauschgift ersten Ranges, ein Genußmittel, dem im Orient Millionen von Menschen süchtig verfallen sind, ein Mittel, das nicht anders als das Opium und das Cocain seelische Alterationen bis zu psychotischen Krankheitsbildern hervorruft. Bis jetzt kennen wir in Deutschland noch keinen Haschischgenuß. Und zwar deshalb nicht, weil, wie die Geschichte der Rauschgifte lehrt, der genußsüchtige Mißbrauch an den therapeutischen Gebrauch anzuknüpfen pflegt. Es gab bei uns erst dann einen Cocainismus, als das Medikament Cocain eingeführt worden war, und es gibt weiter Cocainismus, nachdem schon das Cocain die Therapie fast verlassen hat. Es gibt keinen Haschischismus, weil der Hanf therapeutisch keine Rolle spielt. Wir werden ihn haben, wenn man den indischen Hanf popularisiert, und wir werden ihn haben, auch wenn er sich dabei therapeutisch nicht besser bewähren wird als bisher.“ Daraufhin fordert er Maßnahmen, „durch die das wissenschaftliche Arbeiten mit einheimisch wachsendem indischen Hanf unangetastet bleibt, aber sein Verkehr und seine Verbreitung schärfstens überwacht und nach Gesichtspunkten des medizinalen Bedarfs geregelt werden.“ Das „englische Welthandelsmonopol“ könnte man „leicht dadurch gegenstandslos machen, daß man – ohne Schaden – bei den Hühneraugenmitteln Cannabis indica fortläßt.“
Die so ins Rollen gebrachte Diskussion über die Notwendigkeit eines Anbaus von Indischem Hanf in Deutschland fand ihre Fortsetzung in der Antwort von Sabalitschka (Klin. Wschr. 9.7.1926), in der er einen totalen Rückzieher machte und die Versuche nur noch aus einer Bedarfssituation heraus verteidigte: Es „bestand und besteht heute noch in Deutschland ein Bedarf nach Herba Cannabis Indicae und dem daraus bereiteten Extrakt, wenn dieser Bedarf auch nicht erheblich ist. Der Bedarf Deutschlands konnte in der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht mehr durch Import gedeckt werden.““Es war somit wirtschaftlich angezeigt oder notwendig, die Erzeugung einer dem echten indischen Hanf nahekommenden Droge in Deutschland zu versuchen.“ „Selbstverständlich soll der Anbau sich nur in den Grenzen dieses Bedarfes halten, soweit nicht auch Ausfuhr möglich ist. Der Anbau muß auch so durchgeführt werden, daß er nicht zu einer Verwendung der Droge als Genußmittel in Deutschland führt.“ „Eine Popularisierung ist wegen der damit verbundenen Gefahr des Haschischismus und einer Überproduktion zu vermeiden.“ Und zaghaft: „Durch sachgemäße Kultur unter Kontrolle durch Pharmakologen und Chemiker erscheint es möglich, zu gleichmäßiger Droge und gleichmäßigen Präparaten zu kommen, wodurch die pharmakologischen und klinischen Versuche über die Wirkung dieser Pflanze und ihrer Inhaltsstoffe unterstützt würden. Von dem Ergebnis dieser Untersuchungen wird dann die Entscheidung abhängen, ob der indische Hanf weiterhin in der Therapie irgendwie verwendet werden oder ob er allgemein aus der Therapie und den Arzneibüchern verschwinden soll.“
Joel setzt in einer „Erwiderung“ noch einen drauf, indem er eine eigene Untersuchung vorlegt, die den Einsatz von Cannabis indica-Extrakt als lokalanästhetischen Zusatz bei der Behandlung von Hühneraugen, wie dies ein Mann namens Unna Ende des 19. Jahrhunderts empfohlen und eingeführt hatte, auf Grund einer mehrere Tage anhaltenden hautreizenden Wirkung sogar als kontraindiziert erscheinen läßt. „Man bemüht sich gegenwärtig vielfach, unnütze und verteuernde Ballastbestandteile aus der Therapie zu entfernen. Hier liegt ein geeigneter Fall vor. Wir brauchen weder Einfuhr noch Anbau von indischem Hanf und sollten froh sein, mit einem zwar wissenschaftlich interessanten, sonst aber ebenso überflüssigen wie gefährlichen Mittel nichts zu tun zu haben.“
Aber zurück zu den jahrelangen Anbauversuchen: Wie bereits erwähnt, begann man, als sich während und nach dem Ersten Weltkrieges Schwierigkeiten bei der Einfuhr von Herba Cannabis Indicae (Indischem Hanfkraut) ergaben, mit den besagten Versuchen, „in Deutschland indischen Hanf anzubauen und eine hochwertige Droge zu erzielen“. Der Versuchsstation in Happing war es „gelungen, die Samen der echten Cannabis indica „Gunjah“ nach Deutschland zu bringen, mit welchem die Versuche angestellt wurden. Bei der Selektion strebte die Versuchsstation nicht nur nach einer Pflanze von hohem Harzgehalt, sondern auch von einem typischen, von der gewöhnlichen Cannabis sativa möglichst verschiedenen Aussehen.“ Es war schließlich „tatsächlich eine typische Form erreicht worden; sie ist schwächer und graziöser als die gewöhnliche Form und entspricht dem Habitus des indischen Hanfes. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Form noch charakteristisch durch die tiefdunkle Färbung der Stengel und Stiele…
Die Züchtung dieser Form bot den Vorteil, schon aus dem äußeren Habitus Rückschlüsse auf den Harzgehalt der Pflanze ziehen zu können, während man sonst den Harzgehalt nur aus der größeren oder kleineren Klebkraft der Pflanzen beim Anfassen schätzen kann.“ Es gelang auch den Harzgehalt des geernteten Hanfkrautes erheblich zu erhöhen. Liessen sich aus dem „Ersten Nachbau aus indischen Originalsamen“ im Jahre 1917 noch nur 8,7 % Extrakt gewinnen, waren es 1918 bereits 12,4 %, 1919 17,3 %, 1920 19,8 % und 1921 20 %. In den folgenden drei Jahren pendelte sich der Wert bei knapp 19 % ein. Es wird allerdings eingeräumt, daß es sich hierbei um Werte einer besonders guten hochwertigen Droge handle. „Für die durchschnittlich geerntete Droge lagen die Werte um 1-2 % niedriger.“ Zur Extraktion verwendete man 90 %igen Alkohol. Das nach Verdampfung des Extraktionsmittels erhaltene Produkt würde man heute „Grasöl“ nennen. Interessant auch die Schlußfolgerung der Anbauversuche: „Daraus ergibt sich, daß auch in Deutschland die Gewinnung eines Hanfes mit hohem Harzgehalt möglich ist und daß der Harzgehalt weniger vom Klima abhängt, sondern vielmehr von der Hanfrasse. Der gewöhnliche Hanf erzeugt in Deutschland ebensowenig größere Harzmengen, wie in Indien.“ Damit erklärten sich auch die früheren gescheiterten Versuche aus dem gängigen Faserhanf ein psychoaktives Präparat zu gewinnen. Obendrein zeigte sich bei den Happinger Anbauversuchen noch, „daß der indische Hanf durchaus nicht so kälteempfindlich ist“. Dennoch sollte sich vor allem der Mythos, von der klimatischen Abhängigkeit der Hanfpotenz, von zahllosen Publikationen wiedergekäut, noch über Jahrzehnte halten, ganz im Sinne der Hanfprohibition, der eine unabhängige Selbstversorgung der Konsumenten durch einen einfachen und unproblematischen Anbau in Haus, Garten und weiter Flur natürlich ein Greuel ist, wie ja jüngst das absurde Hanfsamenverbot und die Hatz auf Homegrower deutlich belegen.
1920 kam das Deutsche Cannabis Indica-Kraut erstmals auf den Markt. Der Handel in Deutschland unterlag damals noch keinen Reglementierungen. Erst 1929 wurde der Indische Hanf durch Aufnahme in das internationalen Abmachungen von 1925 folgende Opiumgesetz verboten und verschwand aus dem freien Drogenhandel. Die Indische Ware wurde Mitte der Zwanziger Jahre teurer und schwerer erhältlich, und schließlich durch als weniger ergiebig geltendes Hanfkraut aus Zansibar (Ostafrika) verdrängt. (W. Wiechowski in Prag gewann mit Petroläther aus der Indischen Droge 20 %, aus der Afrikanischen 8 % und aus der Deutschen 5 % harzigen Extrakt, wobei hier nichts über den wahren Gehalt der damals noch unbekannten Wirkstoffe gesagt war. Arch. f. Exp. Path. u. Pharm. 119. Bd. 1927) So kostete beispielsweise bei dem Hamburger Drogen- und Chemikalienhändler „Krenzin & Seifert“ Indisches Hanfkraut 1924 noch pro Kilo 15 Mark. 100 Kilogramm waren für 1450 Mark zu haben. 1925 kostete es aber bereits 35 Mark pro Kilo. Die afrikanische Ware war dagegen für 12 Mark das Kilo erhältlich. Die Drogengroßhändler „Caesar und Loretz“ in Halle, die auch eigene Anbauversuche mit Cannabis indica unternahmen und sich der in Happing produzierten Ware annahmen, hielten diese „im allgemeinen noch für besser als die afrikanische, so daß man sich mit ihr als Ersatz für die nicht zu beschaffende, echte, indische voll begnügen könne.“
Um die psychoaktive Wirkung des oberbayrischen Hanfkrautes zu belegen, konnte man letztlich auf Menschenversuche nicht verzichten. Zunächst mußte ein starker Tabakraucher ran. Während die erste Pfeife mit 2 Kubikzentimeter Inhalt keine Wirkung zeigte, hatte er nach der zweiten Pfeife „ein merkwürdiges Gefühl von Frohsein, ohne es einer Berauschung vergleichen zu können. Es war ungefähr so, wie morgens 11 Uhr ein Glas guter Weißwein wirkt.“ „Eine dritte Pfeife erzeugte nach Ablauf von ungefähr einer Stunde Ermüdung und ich schlief häufig 4-5 Stunden länger als sonst.““Nachwehen des Hanfrauchens verspürte ich nie, obwohl ich schon in einer Woche viermal je drei bis vier Pfeifen rauchte. Der Rauch des Hanfes ist nicht angenehm und erzeugt im Anfang etwas Übelkeit.“
Mit soetwas und ein paar Versuchen an Kaninchen und Hunden konnten sich die Forscher nicht begnügen. So bildete das am Pharmakologischen Institut in München (Hermann Gayer, Arch. f. Exp. Path. u. Pharm., 129.Bd., 1928) mittels Petroläther zu 3 % aus dem „Herba Cannabis ind. Happings“ extrahierte Rohharz ab 1925 die Grundlage für Versuche am Menschen. Zum Vergleich wurde persisches Haschisch extrahiert, das einen Harzgehalt von 35 % aufwies. Das Happinger Harz erwies sich allerdings als gleichermaßen potent. Gayer stellte aus dem Extrakt Tabletten her und prüfte deren Wirkung zunächst „sowohl an mir selbst wie auch an mehreren Herren des Institutes, die sich freundlicherweise zu den Versuchen bereit erklärten. Dosen von 1 g Herba können als wirkungslos bezeichnet werden, auch bei 2 g Herba ist noch keine sichere Haschischwirkung zu bemerken, dagegen kann 3 g als bei allen sechs Versuchspersonen wirksam bezeichnet werden. Hier tritt nach etwa 1-2 Stunden jene oft beschriebene unüberwindliche lächerliche Heiterkeit ein, die anfallsweise sich wiederholt. Wehrlosigkeit gegen ideenflüchtige Assoziationen, aufmerksames Lesen ist nicht mehr möglich. In der 3. Stunde apathische Bewegungslosigkeit und Entschlußunfähigkeit, psychisch Halluzinationen und Illusionen, nach 5-6 Stunden übergroße Schläfrigkeit und Schlaf, aus dem man nach 2-4 Stunden in normalem Zustande aufwacht. Bei mehreren Versuchspersonen war auffallend ein in den ersten Stunden eintretender Heißhunger.“ „Dosen von 6 g Herba sind als sehr große zu bezeichnen, hier traten schon starke Rauscherscheinungen auf mit Exaltationen, so daß die Versuchspersonen unter dauernder Überwachung bleiben mußten.“
Von diesen Versuchen berichtete auch Professor Walther Straub („Bayerischer Haschisch“, M. Med. Wschr. 6.1.1928). Ihm zufolge bewirkten bereits 0,05 g des Extraktes oral eingenommen eine „charakteristische Ideenflucht“. „Eine sichere Haschischrauschwirkung“ wurde mit 0,1 Gramm, also entsprechend 3 Gramm des Krautes, erzielt. Es stellte sich ihm zufolge heraus, daß „die Gehirnwirkung, der Rausch nach Kulturherba“ „am Menschen der Qualität nach genau derselben Art“ ist „wie die „künstlichen Paradiese“ der Literatur über orientalischen Haschisch und am Mitteleuropäer wenigstens von derselben problematischen Güte.“ Die „Herren Dr. Kant und Dr. Krapf“, Assistenten der Psychiatrischen und Nervenklinik München wurden von Professor Straub schließlich gebeten, „eine methodische, psychopathologische Analyse der Haschischwirkung“, die „nur vom Fachmann geliefert werden“ könne, beizubringen. Die beiden unterzogen sich daraufhin heroischen Selbstversuchen (Arch, f. Exp. Path. u. Pharm. 129.Bd., 1928) mit dem „Bayerischen Haschisch“. „Der Selbstversuch mit Rauschgiften ist für den Psychiater deshalb von besonderer Bedeutung, weil er ihm am unmittelbarsten das Studium krankhafter seelischer Zustände ermöglicht.“ „Wir sind daher gern der Anregung von Prof. W. Straub gefolgt, die Wirkung von Haschisch am Menschen zu studieren, und haben aus den oben dargelegten Gründen die Form des Selbstversuches gewählt.“ Dabei wurden Dosen eingenommen, die 3 Gramm, 6 Gramm und 9 Gramm des Krautes entsprachen. Auch hier zeigte sich „daß der europäische Kulturhaschisch denselben Rausch erzeugen kann, den im Osten Millionen von Menschen als einzigen narkotischen Genuß des Daseins kennen, pflegen und schätzen.“ Der in Tablettenform eingenommene Extrakt hatte jedoch einen großen Nachteil: Da er nicht in Wasser löslich war, dauerte es Stunden, bis er seine volle Wirkung entfalten konnte und „das einigermaßen begehrenswerte Stadium des euphorischen Rausches eintrat, länger als ein beschäftigter Mitteleuropäer auf einen Genuß warten könnte.“ Mit einer massenhaften Verbreitung des Haschischkonsums in deutschen Landen infolge des Bayrischen Eigenanbaus rechnete Straub nicht. „In den Schilderungen der Europäer über ihren jeweiligen Haschischrausch ist eigentlich nichts enthalten, was so sehr begehrenswert erscheint, und wohl für alle Selbstversucher ist der Haschischrausch nur Episode geblieben.“
Eine interessante Anekdote handelt noch von einer Versuchsperson, die „ohne es zu wissen, eine leere Tablette bekam“ und sich wunderte, „daß die erwartete und bekannte Wirkung nicht auftrat.“ Sie wurde nun „aufgeklärt, daß nur ein Scheinversuch gemacht wurde“. Sie „billigte dies vom wissenschaftlichen Standpunkt völlig und bekam dann die Haschischtablette. Die nunmehrige Haschischwirkung stand nun völlig unter dem nachträglich aufgetretenen Aerger über die Täuschung mit der leeren Tablette, der Aerger steigerte sich bis zur Aggressivität, die Versuchsperson wurde direkt gefährlich!“ Aber war ja auch ne Gemeinheit!;)
Bemühungen , die „mit kleinen Dosen erzielbare Euphorie“ zu nutzen, um „vielleicht einen depressiven Melancholiker vergnügt“ zu „machen“ wurden „mit dem bayerischen Haschisch in Angriff genommen“, seien „aber noch nicht spruchreif.“
Kant verabreichte das „Bayerische Haschisch“ später auch noch einigen seiner Patientinnen, um deren Reaktionen zu beobachten (Arch. f. Psych. u. N, Bd.91, 1930). „Wir gaben in der Hälfte der Fälle die wirksamen Bestandteile von 6 g, in der anderen Hälfte von 9 g Herba cannabis indica. Unsere Versuchspersonen waren 9 manisch-depressive und 10 schizophrene Frauen, außerhalb einer Phase bzw. Schubes, jedenfalls frei von akuten psychotischen Erscheinungen.“ Man wollte mal sehen, welche Symptome sich durch die „exogene Noxe“ Haschisch auslösen lassen.
Und schliesslich geriet die ganze kuriose wissenschaftliche Episode in Folge des Opiumgesetzes von 1929 in Vergessenheit. Es war einmal in Bavaria…

hanfblatt Nr. 84, Juli/August 2003
Hanf – Eine Nutzpflanze unter vielen?
Ein Interview mit dem Hanf-Forscher Michael Karus
Michael Karus gilt als der führende deutsche Experte für den Anbau von Hanf. Er ist Geschäftsführer des nova-Instituts, das sich durch die Erforschung der ökologischen Nutzbarmachung der Hanfpflanze einen Namen gemacht hat. Seit dem Erscheinen der deutschen Ausgabe des Bestsellers von Jack Herer „Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf – Cannabis – Marihuana“ im Jahre 1993 und dem im Zusammenhang mit diesem Buch stark angestiegenen Interesse an Produkten auf Hanfbasis sind nun 10 Jahre vergangen, Zeit einmal Bilanz zu ziehen und einige Entwicklungen Revue passieren zu lassen.
Hanfblatt: Wie steht es mittlerweile um den Hanfbau in Deutschland? Wie hat er sich in dem zurückliegenden Jahrzehnt entwickelt?
Karus: Nachdem der Hanfanbau im Jahr 1996 erstmalig seit über 15 Jahren Anbauverbot wieder möglich war, ist die Hanfanbaufläche zunächst stetig gewachsen (bis auf knapp 4.000 ha in 1999) und dann aber wieder auf ca. 2.000 ha gefallen (2002). Für dieses Jahr erwartet man wieder einen leichten Anstieg. Grund für diese Entwicklung waren zu Beginn überzogene Erwartungen an den Markt, die Absenkung der EU-Beihilfen und damit einhergehend ökonomische Probleme, die bereits zum Aus für einige Aufschlussanlagen wurden.
Hanfblatt: Hat der Hanfanbau in Deutschland eine Chance, sich gegen ausländische Konkurrenz zu behaupten?
Karus: Ja! Der Bedarf an Hanffasern kann in Deutschland weitgehend durch die deutsche Produktion gedeckt werden. Die EU dürfte inzwischen sogar eher Hanffasern exportieren als importieren.

Hanfblatt: Welche Bedingungen müssen geschaffen werden, damit Hanf sich gegen konkurrierende Rohstoffe durchsetzen kann?
Karus: Wenn Hanffasern zu Weltmarktpreisen produziert werden können, so gibt es kein Problem mit dem Absatz. Die Nachfrage nach Naturfasern, insbesondere in der Automobilindustrie, wächst stetig. Wenn Preis und Qualität stimmen, können die Fasern abgesetzt werden. Allerdings ist es nicht leicht, bei sinkenden EU-Beihilfen den Preis auf Weltmarktniveau zu halten. Dies wird nur durch verbesserte Aufschlusstechnik, höhere Durchsätze und geschickte Vermarktung der Nebenprodukte (Schäben und Samen) möglich sein.
Hanfblatt: Hat der Hanf den in ihn gesetzten Erwartungen entsprechen können, oder ist er doch nur eine Nutzpflanze von vielen?
Karus: Hanf war immer nur eine Nutzpflanze unter vielen. Alles andere war und ist Ideologie und irrationales Wunschdenken – und keine Basis für reale Geschäfte. Aus Hanf kann man tausende Produkte machen. Aber auch aus Soja (und vielen anderen Pflanzen) kann man tausende Produkte machen. Aber: Im Gegensatz zu Hanf macht man aus Soja bereits tausende Produkte … Das einzig wirklich Besondere an Hanf ist, dass bestimmte Sorten den bewusstseinsverändernden Stoff THC in relevanten Mengen enthalten. Dies hilft aber nichts, um die Fasern, Schäben oder Samen in den Markt zu bringen. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar eher hinderlich.
Hanfblatt: Kann man sagen, dass der ersten Euphorie eine gewisse Ernüchterung gefolgt ist?
Karus: Wer heute noch im Nutzhanfbereich tätig ist, ist dies nicht mehr aus ideologischen Gründen oder Wunschträumen, sondern unter den realen Rahmenbedingungen des Marktes. Die anfängliche Euphorie hat zum Teil das Marketing von Endkonsumenten-Produkten erleichtert. Diese Produkte bestanden aber oft nur zu marginalen Anteilen aus Hanf (echte Hanfanteile in vielen Shampoos, Bieren oder Limonaden unter 1%) bzw. kamen ihre Rohstoffe vor allem aus China und Rumänien.
Hanfblatt: Wie steht es mit der verarbeitenden Industrie? In welchen Bereichen rechnet sich die Hanfverarbeitung?
Karus: Die wichtigsten Märkte für Hanffasern sind die Automobilindustrie (Formpressteile wie Türinnenverkleidungen) und die Dämmstoffindustrie. Weiteren Einsatz finden die Fasern in Anzuchtvliesen für Kresse (in jedem Supermarkt!). Die Schäben werden primär als Tiereinstreu (Pferde und Kleintiere) eingesetzt und die Samen gehen vor allem als Tierfutter über die Theke. Hier gewinnt allerdings der Lebensmittelbereich (Samen, Öl) an Bedeutung.
Hanfblatt: Kann man einem Bauern noch mit gutem Gewissen den Hanfanbau empfehlen? Auf was sollte er achten? Welche Voraussetzungen müssen stimmen?
Karus: Wieviel Hanf dem Bauern pro Hektar bringt, kann heute leicht berechnet werden. Der Anbau lohnt sich, wenn im Umkreis von 50 km ein Faseraufschlussbetrieb existiert, der hinreichend viel für das Hanfstroh zahlt. Wo dies genau anzusiedeln ist, hängt vor allem von den regionalen Konkurrenzkulturen ab.
Hanfblatt: Die HanfHaus-Kette musste ja bekanntlich Konkurs anmelden. Hat sich wenigstens insgesamt ein stabiler Absatzmarkt entwickeln können und was muss noch geschehen, damit sich das Potential von Hanf als Rohstoff besser entfalten kann?
Karus: Dies habe ich oben schon beantwortet. Und noch einmal: Die HanfHaus-Kette hat außer ein paar Samen und Ölen praktisch nichts verkauft, was von deutschen Äckern stammte, sondern vor allem Produkte (insb. Textilein) aus China und Rumänien.
Hanfblatt: Herer und sein Übersetzer Bröckers sind ja mit der provokanten These angetreten, dass Hanf als nachwachsender Rohstoff die Welt retten könne, zumindest vor den Folgen des Raubbaus an unersetzlichen Urwäldern, der Verschwendung fossiler Rohstoffe und Energieträger und unökologischer Landwirtschaft wie dem monokulturellen Anbau von Baumwolle. Kann man diese Behauptung so immer noch stehen lassen oder muss man sie revidieren?
Karus: Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Jack hat ja sogar einen Preis für denjenigen ausgesetzt, der das Gegenteil beweisen könne. Für uns wäre dies ein Leichtes. Ich habe diesbezüglich auch mit Jack Kontakt aufgenommen. Wir haben uns aber nicht darüber einigen können, was er als Beweis akzeptieren würde ….
Hanfblatt: Wie sieht die Zukunft für den Hanf aus?
Karus: Gut! Hanffasern werden sich als industrielle Fasern weiter etablieren, Schäben werden (und sind) eine feste Größe für hochwertiges Tiereinstreu, und Hanfsamen werden sich mehr und mehr als gesundes Lebensmittel etablieren. Und auch im pharmazeutischen Bereich ist der Wall gebrochen, mehrere Unternehmen werden in den nächsten Jahren neue Präparate auf den Markt bringen.
Hanfblatt: Woher kommt Ihr besonderes Interesse am Hanf?
Karus: Das Interesse ist garnicht mehr so besonders. Wir beschäftigen uns inzwischen auch mit vielen anderen nachwachsenden Rohstoffen. Es gab halt damals in den Jahren 1993 bis 1997 die historisch günstige Situation, dass sehr viel Interesse an den Nutzungsmöglichkeiten von Hanf bestand und gleichzeitig kaum belastbares Wissen existierte. Diese Chance haben wir genutzt, um das nova-Institut als Experten-Institut für Hanf zu entwickeln. Heute ist bei uns ein so großes und breites Wissen über Hanf (und andere Faserpflanzen) verfügbar, ebenso wie zahlreiche nationale und internationale Kontakte, dass die Hanfforschung – insbesondere die Marktforschung und ökonomische Analysen – immer noch eine wichtige Einnahmequelle darstellt.
Hanfblatt: (scherzhaft) Ist es einsam auf dem Olymp?;-)
Karus: Im Gegenteil: Ich habe über den Hanf unzählige interessante Menschen in der ganzen Welt kennen gelernt, von denen viele meine Freunde geworden sind.
Interview mit Mathias Bröckers
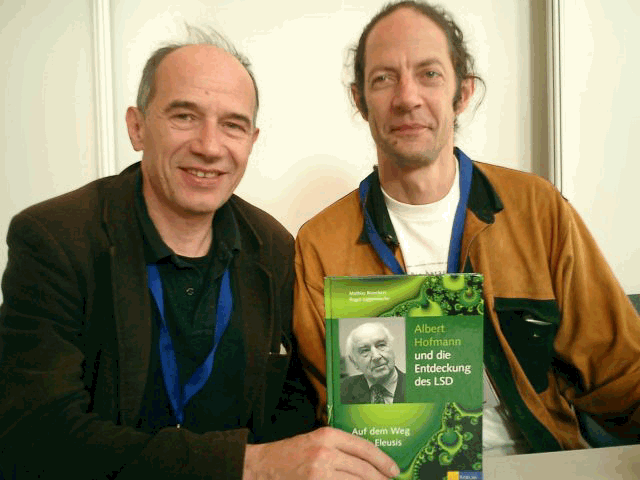
Der ganze Drogenkrieg kippt…
Ein Interview mit Mathias Bröckers
Der Journalist und Autor Mathias Bröckers gehört zweifellos zu den umtriebigsten und präsentesten Promis auf dem Hanfaktivistenolymp. Anlass genug für das Hanfblättli, ihn einmal wie einen Hanfsamen auszuquetschen. Fangen wir harmlos an…
HanfBlatt: Du beschäftigst dich seit nunmehr drei Jahrzehnten von verschiedenen Seiten aus mit dem Thema Hanf. Zu deiner Legende gehört die Freundschaft zu dem leider verstorbenen großzügig bekiffte Weisheit und Poesie brabbelnden Hanfsadhu Wolfgang Neuss. Wie kam es dazu?
Bröckers: Das war 1981. Ich war damals Kultur-Redakteur der „taz“. Es war die Zeit der Hausbesetzungen in Berlin, und Freunde, die für das Radio arbeiteten, hatten ihn dazu interviewt. Das heisst, sie hatten eine einzige Frage gestellt und Neuss hatte darauf einen seiner genialischen Monologe abgelassen: „Also Hausbesetzer ist schon mal das falsche Wort, Hausbenutzer würde ich da erst mal sagen, denn sie benutzen ja nur etwas, was ungenutzt rumsteht…“ so ungefähr fing das an und kam dann vom hundertsten ins tausendste und wieder zurück. Ich war völlig hingerissen von diesem assoziativen Mix, der immer wieder auf den Punkt, die Pointe kam, und das in einer unerhörten politischen Schärfe und Genauigkeit, so dass ich beim nächsten Mal, als der zweite Teil des Interviews gemacht werden sollte, mitgekommen bin und ihn gefragt habe, ob er nicht eine wöchentliche Kolumne für die „taz“ machen will. Dass wir uns dann so gut kennengelernt haben und Freunde wurden, hatte mit den Bedingungen zu tun, die er für diese Kolumne stellte: Du mußt drei mal in der Woche hier vorbeikommen, einmal um das Thema zu besprechen, dann zwei Tage später den Text abholen, und dann das Honorar vorbeibringen und von den Reaktionen berichten – „und jedesmal mußt du mit mir rauchen!“ Ich stimmte zu, ahnte aber noch nicht, was da Besonderes auf mich zukommt…
HanfBlatt: Was war das Besondere?
Bröckers: Dass sich in jedem seiner von ausgewählten Fachleuten gerollten Joints exakt 1,5 Gramm bestes Haschisch befanden und von diesen Raketen täglich mindestens 20 gezündet wurden – und ich war anfangs schon nach zwei Zügen völlig platt. War es schon im Wachzustand schwer, der Geschwindigkeit seiner Intelligenz und dem Wortwitz zu folgen, blickte ich jetzt gar nichts mehr und dämmerte vor mich hin. Die ersten Kolumnen apportierte ich stolz – und mußte zu Hause sofort ins Bett. Ich sagte dann: „Wolfgang, ich kann nicht so viel rauchen bei dir, ich krieg erst Hunger und dann Durst und dann werde ich völlig breit im Kopf, kann mich nicht mehr konzentrieren, werde dösig und dämmerig…“ – „Bröckers“, meinte er dann, “ du mußt üben. Du bildest dir das alles nur ein mit dem Hunger, dem Durst, der Verwirrung, der Müdigkeit. Wer bei der besten Zeitung Deutschlands das angeturnteste Feuilleton machen will, muß doch wissen, wie man mit Drogen – mit Ekstase – richtig umgeht. Du mußt lernen, high zu sein und gleichzeitig hellwach, entspannt und gleichzeitig hochkonzentriert, auf der Erde, top-professionell, und gleichzeitig im Himmel, völlig abgefahren…“ Unter seine Briefe schrieb er gern: „Nach Diktat abgefahren“.
HanfBlatt: Und, hast Du was gelernt?
Bröckers: Zumindest war ich bis zu seinem Tod 1989 einer der fleissigsten Studenten, auch wenn ich die Neuss’sche Meisterschaft nie erreicht habe. Der konnte ja auch 20 starke LSD-Trips auf einmal nehmen und klar und ruhig sitzen bleiben – so wie Neem Karoli Baba, der indische Guru von Tim Learys Harvard-Kollegen Richard Alpert (Ram Dass). Was Hanf betrifft, habe ich tatsächlich gelernt, die meisten unerwünschten Nebenwirkungen zu kompensieren und nur die jeweils erwünschten zuzulassen. Weil ich ab 1982 als Vater von Zwillingen nach Büroschluss keine Zeit für regelmäßige Feierabend- Sessions bei Neuss hatte, verlegten wir von da an unsere Treffen auf 7 Uhr früh. Das war nun eine echte Herausforderung, denn um 10 war die Redaktionskonferenz der „taz“ und danach musste die aktuelle Zeitung gemacht werden. Wolfgang war oft schon seit 5 Uhr wach und hatte nicht schon einige Tüten, sondern auch alle Morgen-Zeitungen intus. Wir frühstückten dann an der Ecke im Café Möhring und danach in der Wohnung stellte ich das Tonband an, der Vulkan sprudelte los und ließ Lokalklatsch und Globalstrategien, Privatclinch und Weltkrieg, Kleinkunst und Großkultur, Tagesaktualität und Ewigkeit kollidieren, in einem Satz. So sind dann die meisten seiner Kolumnen entstanden – und ich habe nebenbei über die Jahre gelernt, stoned zu sein und gleichzeitig wach, konzentriert und arbeitsfähig.
HanfBlatt: Das ist allerdings eine Leistung, die Anfängern bisweilen Schwierigkeiten macht. Mag sein, dass es auch ein wenig von der Persönlichkeit abhängt. Was können wir heute noch vom Spassmeister Neuss lernen?
Bröckers: Nun, was seinen Haschisch-Verbrauch angeht, kann er sicher nicht als Vorbild dienen. Andererseits muss man die Vorgeschichte sehen, er war ein Superstar des Wirtschaftswunderlands in den 50ern, mit seinem Partner Wolfgang Müller eine Art Laurel & Hardy auf deutsch, dann in den 60ern die Nr. 1 des Kabaretts, allseits geliebt, hochbezahlt, ständig auf Achse, aber ständig auf Aufputsch-und Schlaf-Tabletten und Alkohol. Hätte er so weiter gemacht, hätte er die 70er nicht überlebt: „Ich rauche den Strick an dem ich hängen würde“ meinte er später und hat, außer etwas Opium gegen die Krebsschmerzen in den letzten Monaten, keinerlei Pillen oder Alkohol je wieder konsumiert. Ausser Hanf (und Psychedelika) ließ er nie wieder eine Substanz an sich heran. Also insofern können wir selbst aus dieser extremen Drogengeschichte etwas lernen. Darüberhinaus ist Neuss (geb. 1923) für mich einer der herausragenden Künstler-Heroen der „Stalingrad“-Generation – ein kleiner brauner Fleischergeselle, der sich im Schützengraben den Finger abschießt, um ins Lazarett zu kommen, dort als Witzeerzähler und Frontkomiker erstmals Beifall erhält, die Komik als lebensrettend entdeckt, zum opportunistischen Medien- und Filmstar avanciert, aber dann politisch wird, als Vordenker und Lautsprecher der 68er Kultur-Revolution. Und noch in seiner angeblichen „Verkommenheit“ später, als letzter Hippie und erster Punker der Republik, ein höchst sensibler und sprachgewaltiger Seismograph gesellschaftlicher Entwicklungen. Der intelligenteste Mensch dem ich je begegnet bin, dieser Schlachtergeselle aus Breslau. Und was das Professionelle betrifft ein wahrer Großmeister seines Fachs. Nehmen wir nur den aktuellen Champion Harald Schmidt: Was heute eine 30-köpfige Redaktion an Witz in die abendlichen Konferenzen einbringt, zauberte Neuss jeden Tag locker im Alleingang. Ich habe diese „Early Morning Shows“ jahrelang erlebt und mir bei verschiedenen Fernsehfritzen den Mund fusselig geredet, aber leider gab es in den 80ern noch kein entsprechendes TV-Format, sonst wäre das Ungeheuer von Loch Neuss garantiert noch einmal ganz groß herausgekommen. Wolfgang als zugeschaltetes Orakel der Harald Schmidt Show wäre eine unschlagbare Kombination. Aber ich will hier nicht schwärmen, sondern den Lesern seine Bücher und CDs empfehlen. Die alten Sachen in Volker Kühns Werkausgabe „Das Wolfgang Neuss Buch“ bei Zweitausendeins, die neueren auf CD bei Conträr. Das Buch, das ich aus seinen taz-Kolumnen zusammengestellt habe („Der gesunde Menschenverstand ist reines Gift“, Heyne-Verlag 1986) ist leider lange vergriffen, aber die besten Texte wurden in die letzte Auflage des Zweitausendeins-Bands aufgenommen.
HanfBlatt: Den eigentlichen Treffer hast Du selbst aber erst mit der Wiederentdeckung eines bereits in mehreren unübersichtlichen und zusammengeschustert wirkenden Auflagen erschienenen Buches namens „The Emperor wears no Clothes“ gelandet. Was hat Dich bewogen dieses Werk eines alten amerikanischen Hippies namens Jack Herer in einer ansprechenden Form auf Deutsch neu herauszugeben?
Bröckers: Die erste Ausgabe von Herers Buch landete 1987 bei mir. Kurz danach bekam ich einen Auftrag des Magazins „Transatlantik“, eine Reportage über die Cannabis-Szene in Deutschland zu schreiben. In diese Geschichte baute ich die industriepolitischen Hintergründe des Hanfverbots von 1937 aus dem „Emperor“ ein, gab die Buchquelle an und dachte mir, jetzt wird sich sicher ein Verlag dafür interessieren und das Buch auf deutsch herausbringen. Dem war aber nicht so, bis ich 1992 Lutz Kroth von Zweitausendeins beiläufig von der Story erzählte. Der fand Jacks Buch sehr spannend, aber zu chaotisch, und meinte: „Wenn Du die Redaktion übernimmst, machen wir es.“ Und ich sagte: „Ich mache es nur, wenn wir es auf Hanfpapier drucken.“ So kam dann nicht nur das Buch, sondern auch das HanfHaus ins Rollen. Ich organisierte die Hanfpapier-Produktion, und plötzlich wollten alle dieses Papier und die anderen Produkte aus Hanf. Als die Übersetzung fertig war und mein Teil über die europäische und deutsche Industrie-Geschichte des Hanfs ebenso, klang das ganze so plausibel, dass es uns niemand abgnommen hätte. Viele hätten einen Fake vermutet. Deshalb bat ich das Katalyse-Institut um eine wissenschaftliche Studie über den Rohstoff Hanf, die wir quasi als offizielle Bestätigung anhängten. Außerdem checkte ich alle Quellen und Dokumente, aber ich fand keinen Haken – und bisher hat auch niemand einen gefunden. Bis auf eine in der 2. Ausgabe korrigierte falsche Zahl über den Ölertrag hat uns seitdem niemand einen Fehler nachgewiesen – und das Buch hat mittlerweile eine Auflage von 140.000.
HanfBlatt: Wie war die Zusammenarbeit mit Jack Herer, der dadurch wohl zu den Ehren kam, von denen er immer geträumt hatte?
Bröckers: Wir lernten uns im Sommer ’93 in Paris auf einer Hanf-Konferenz kennen, da war die deutsche Ausgabe schon fast fertig. Jack war wunderbar einquartiert, auf einem Hausboot auf der Seine mitten in der Stadt, und wir redeten vom Abend bis zum Morgengrauen. Als ich ihm die Kopie der „Lustigen Hanffibel“ von 1943 zeigte, die ich gerade zuvor in der Staatsbibliothek entdeckt hatte, war er völlig aus dem Häuschen – dass auch die Nazis „Hemp for Victory“ anpflanzen ließen, schien ihm wie das Tüpfelchen aufs i. Meine anfänglichen Bedenken, so ein Nazi-Dokument zu veröffentlichen, wischte er energisch vom Tisch. Jack ist Jude, seine Eltern kamen in den 30ern aus Polen in die USA. „Wir müssen das veröffentlichen“, meinte er, „die Cannabis-Raucher sind doch die Juden von heute, sie werden verfolgt und eingesperrt für NOTHING. Wenn du ein faschistisches System kennenlernen willst, komm nach USA. Sie fordern die Kinder in der Schule auf, die Eltern zu denunzieren wenn sie Pot rauchen und bevor du einen Job kriegst, wollen sie deinen Urin schnüffeln.“ So kam also die Hanf-Fibel in die deutsche und auch in die nächste US-Ausgabe. Was die Ehre betrifft, hatte Jack die in USA schon genug, aber was nützt die tollste Geltung wenn man kein Geld hat. Das habe ich ihm mit der deutschen Ausgabe endlich mal verschafft und bin deshalb natürlich sein dickster Buddy. Er hat sich keinen Benz davon gekauft, sondern wie bei ihm üblich die Bewegung damit gepusht. Dass Hanf in Kalifornien zumindest als Medizin für Schwerkranke mittlerweile legal ist, verdankt sich auch seinem unermüdlichen Einsatz. Weil er aber zuviel isst und sich zuwenig bewegt, hat letztes Jahr sein Herz gestreikt – seitdem muss er sehr langsam tun.
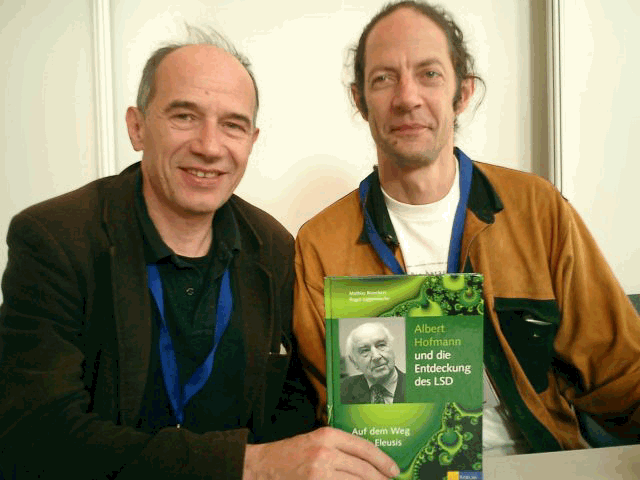
HanfBlatt: „Hanf – Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Cannabis Marihuana“ ist ein echter Bestseller geworden und ein Motor der Veränderungen, die in Sachen Hanf in den letzten Jahren hierzulande stattgefunden haben. Nicht vergessen darf man dabei allerdings das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994, das praktisch eine teilweise Entkriminalisierung des Besitzes geringer Mengen Rauschhanfs zur Folge hatte und die ganze Hanfwelle mit mehreren Zeitungen und einem Boom an Head- und Grow-Shops, sowie mancherorts von den Strafverfolgungsbehörden ignorierten Coffeeshop-artigen Erwerbsläden initialzündete. Wie erklärt sich aus deiner Sicht der Erfolg des Buches? Was hat es bewirkt?
Bröckers: Erstmal eine generelle, grundsätzliche Imageverbesserung. Dieser ganze Dämonisierungs-Humbug schwirrte ja, seit den 30er Jahren implantiert, nach wie vor mächtig in den Köpfen, und das wurde mit der geballten Faktenladung des Buchs zurechtgerückt. Dieser Re-Education-Effekt war das Entscheidende für den Erfolg. Die Tatsache, dass z.B. viele Schüler und Jugendliche das Buch ihren Lehrern und Eltern in die Hand drücken konnten und das Tabu, über das Pfui-Bah-Thema „Rauschgift“ zu reden, gebrochen war. Plötzlich war tatsächlich wieder von Hanf die Rede und nicht nur von Hasch & Drogen. Hans Georg-Behrs Buch, das ja so hieß, „Von Hanf ist die Rede“, hatte das zehn Jahre zuvor noch nicht geschafft, weil es den ökologischen Aspekt der Hanfnutzung nicht berücksichtigte. Dass nun Jack Herer und mir die Vaterschaft der Hanf-Renaissance zugeschrieben wird, wurmt ihn ein bißchen, und deshalb erzählt er jedem, der es nicht hören will, wir hätten alles bei ihm abgeschrieben. Das ist natürlich Unsinn, auch wenn, ebenso natürlich, alle nützlichen Informationen aus seinem Buch in unseres eingeflossen sind, aber eben auch noch einiges mehr. Und dieses Mehr, die Tatsache, dass jetzt die ganze Pflanze, statt nur der Rausch-Aspekt, Thema war, brachte die entscheidende Wende. Als ich die ersten zehn Exemplare des Buchs frisch aus der Druckerei bekam, schickte ich sieben davon nach Karlsruhe an die sieben Verfassungsrichter. So wie die hervorragende Arbeit von Wolfgang Neskovic auf der juristischen Seite, hat das Buch auf der publizistischen Seite wohl entscheidend zu der Trendwende in Sachen Hanf beigetragen. Dazu kam dann das Gerichtsverfahren um den Anbau von Nutzhanf, das wir mit der „Hanfgesellschaft e.V.“ initiiert hatten und das 1996 erfolgreich war. So kam Hanf zurück auf die Felder. Und das HanfHaus, das als erstes Unternehmen in Deutschland wieder Produkte aus Hanf auf den Markt brachte, löste einen wahren Gründerboom aus. Seitdem ist die Pflanze fast in jeder Stadt wieder präsent. Und wie bei jedem Pionier-Boom üblich – am IT-Markt haben wirs gerade erlebt – folgt solch stürmischen Wachstumsphasen zwangsläufig ein Tief. In der Hanfbranche setzte das 1998 ein, zusätzlich forciert durch die Verschärfung der Gesetze zum Samenverkauf. So ganz tatenlos wollte die Kohl-Regierung den blühenden Hanflandschaften dann doch nicht zusehen. Auch die Schikanen in Sachen Führerschein, die dann einsetzten, sind ja nichts als ein plumper Versuch, hinterrücks auf die Hanfbremse zu treten – wo doch das Verfassungsgericht beim Gesetzgeber eigentlich angemahnt hatte, die Repressionen zu lockern. Was die legalen Hanfprodukte betrifft, so blieb von allen Produkten, die das HanfHaus auf den Markt brachte, kein einziges unbeschlagnahmt – ob Hosen, Shampoo, Möbelöl oder Unterhosen. Solche Schikanen machen den Aufbau neuer Märkte für den Rohstoff Hanf nicht leichter – ganz abgesehen davon, dass es nachwachsende Rohstoffe gegen die petro-chemische Konkurrenz sowieso schon schwer genug haben. Aber trotz all dieser Schwierigkeiten, bin ich als Schreiberling mit der Wirkung des Buchs mehr als zufrieden. Es bestätigt den Schmetterlingseffekt der Chaostheorie: Auch ein kleiner Furz kann, im richtigen Moment gelassen, weltbewegende Wirkung haben. Und dieses Buch, das eine Weltauflage von über 500.000 hat, hat tatsächlich schon einiges bewegt in der Welt und tut es weiter. 70 Jahre Desinformation lassen sich nicht in 7 Jahren umdrehen, aber es fehlt nicht mehr viel! Der ganze Drogenkrieg kippt… und ein Cannabis-Friede wird der Anfang vom Ende dieses Kriegs sein.
HanfBlatt: Ich möchte gerne nochmal den inhaltlichen Aspekt des Buches ansprechen. Kernthese des Buches ist, dass Hanf nämlich eine anspruchslose und dabei ungeheuer produktive und äusserst vielseitig nutzbare Pflanze ist. Hanf allein könnte als nachwachsender Rohstoff einen Großteil der Probleme beseitigen, die gegenwärtig dadurch entstehen, dass insbesondere zur Cellulose-, Baustoff-, Faser-, und Ölgewinnung unersetzbare Rohstoffe ausgebeutet werden, namentlich Rohöl und Holz. Auf diese Weise könne Hanf sozusagen die Welt retten. Eine sicherlich verführerische These für jeden Hanffreund. Kritische Stimmen erheben allerdings Bedenken und warnen vor den ökologischen Konsequenzen einseitiger Hanf-Monokulturen. Auch sei die traditionelle Aufschliessung der Hanffasern durch die sogenannte Hanfröste ein Wasser verschwendendes und stark verunreinigendes Verfahren. Was hälst du diesen Bedenken entgegen?
Bröckers: Verglichen mit den Pestizid-Orgien des industriellen Baumwollanbaus ist die Wasserröste doch ein völlig harmloses Verfahren – kein Gramm Chemie kommt zum Einsatz, auch wenn die Brühe, in der die Hanfstengel aufgeweicht wurden, natürlich nicht einfach in den nächsten Fluß geleitet werden kann. Wenn sie aber, wie das z.B. in Rumänien geschieht, als Düngung wieder auf die Felder kommt ist das ökologisch absolut in Ordnung – ein Kreislauf. Dennoch können so altertümliche Verfahren in Zukunft nicht konkurrenzfähig sein, schon gar nicht von der Baumwolle irgendwelche nennenswerten Marktanteile im Textilsektor zurückerobern. Dazu müssen modernere Technologien des Faseraufschlusses, die bereits existieren, vom Labormaßstab in die Praxis umgesetzt werden.
Die These, dass Hanf die Welt retten kann, war natürlich zugespitzt und plakativ, aber ich unterschreibe sie immer noch, auch wenn eine Lösung für die komplexen Probleme des Planeten defintiv nicht ausreicht. Aber Hanf weist überall in die richtige Richtung, ökologisch, ökonomisch, medizinisch und spirituell. Dass der Rohstoff Hanf nach 70 Jahren der Verbote und des Vergessens die Weltmärkte nicht im Sturm zurückerobern kann, ist klar – aber ebenso klar ist, dass er auf ewig als Rohstoff nicht konkurrenzfähig sein wird, solange die Umweltschäden des Baumwollanbaus oder der Waldvernichtung für Papier aus Holz, nicht in die Preise dieser Produkte eingehen. Würde ein konsequentes Verursacherprinzip eingeführt, sind Hanfprodukte schon jetzt konkurrenzfähig und erst recht, wenn sie massenhaft produziert würden. Mono-Kulturen sind dabei übrigens nicht zu befürchten. Hanf ist eine ideale Zwischenfrucht und hinterlässt die Äcker für die Nachfolgepflanzen in optimalem, giftfreien Zustand.
HanfBlatt: Die zweite zentrale These eures Buches lautet: Die rassistische zunächst gegen diskriminierte Minderheiten wie Mexikaner und Schwarze und mit ihnen verkehrende Weisse gerichtete „Marihuana“-Verteufelung, die in den 30er Jahren in den USA unter Harry J. Anslinger, dem langjährigen Leiter des U.S. Narcotics Bureau, begann, diente in erster Linie der Diskreditierung des Hanfes. Es existierte eine Verschwörung von Grössen aus der Holz- und Chemieindustrie, die dadurch den lästigen Konkurrenten Hanf ausschalten wollten. Hier führen Kritiker an, dass der Hanf, sofern er der Berauschung diente, auch schon vor Anslinger in vielen Ländern umstritten war und bekämpft wurde, in manchen Ländern wie Ägypten schon seit Jahrhunderten. Auch die internationalen Gesetze gegen Opium, Opiate und Kokain schlossen den „Indischen Hanf“ schon in den 20er Jahren mit ein. Die Verteufelung habe also vielerorts eine erheblich längere Geschichte. Einen nicht unerheblichen Teil daran habe auch die westliche Medizin und die Pharmaindustrie gehabt. Auf der anderen Seite sei der Hanf z.B. in Deutschland schon Ende des 19. Jahrhunderts auf Grund zu hoher Verarbeitungskosten gegenüber ausländischen Faserpflanzen (wie Baumwolle, Jute etc.) nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Erst während des Ersten Weltkrieges und zur Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges entsann man sich wieder seiner Qualitäten als einheimische Nutzpflanze. Danach verschwand er wieder langsam in der Versenkung. Der Anbau selbst wurde in der Bundesrepublik ja erst Anfang 1982 verboten. Hat es diese Verschwörung also wirklich gegeben?
Bröckers: Letztes Jahr habe ich mich als Herausgeber des „Lexikons der Verschwörungstheorien“ von Robert Anton Wilson eingehend mit der Struktur von Verschwörungen beschäftigt, die ja eigentlich die selbstverständlichste Sache der Welt sind: A und B verabreden sich heimlich, um sich gegenüber C einen Vorteil zu verschaffen. Das kommt in jedem Fischteich, jedem Biotop vor und auch in jeder Gesellschaft. Ein weiterverbreiteter Irrglaube ist allerdings, das solche Verschwörungen lange, gar über Jahrhunderte andauern. Insofern ist es sicher Unsinn, heute noch von einer Anti-Hanf-Verschwörung zu sprechen – dass aber die Barone der US-Petrochemie wie Irenee DuPont und Andrew Mellon (Gründer von Gulf-Oil) in den 30ern die Fäden für die erste Prohibitions-Kamgagne gezogen haben ist evident: Das Geld für die erste offizielle Anti-Marihuana.Kamgane kam von ihnen und dass ihr Leiter Harry Anslinger Mellons Schwiegerneffe war, ist nicht einfach ein Zufall. Eine großindustrielle Nutzung von preiswertem Faserhanf, die dank der neu entwickelten Maschinen gerade ins Haus stand und vom US-Landwirtschaftsministerium propagiert wurde, hätte die Markteinführung der DuPont-Kunstfasern aus Öl ganz erheblich erschwert. Dennoch ist dieser industriepolitische Hintergrund nicht die einzige Ursache für das Hanf-Verbot, aber er erklärt die Dynamik der Kampagne, die sich dann ja bis in die Single-Convention der UN durchgeschlagen hat. Neben den Geschäftsinteressen der petro-chemischen Industrie spielten auch rassistische, repressive Motive dabei eine wichtige Rolle. Die Hetzpresse von Hearst hatte schon in den 20ern begonnen, eingewanderte Mexikaner und Schwarze als Kriminelle und Drogenabhängige zu denunzieren, der Überhang an Verfolgungsapparat am Ende der Alkohol-Prohibition tat ein übriges. Da passte alles zusammen. Und sorgte dafür, dass die Hanfnutzung bis heute nicht an die technische Moderne angeschlossen ist. Die wunderbaren Fasern meines Hanf-T-Shirts, dass ich auch bei aktuellen 34 Grad Temperatur mehrere Tage tragen kann ohne verschwitzt zu riechen, werden noch so gewonnen wie zu Urgroßvaters Zeiten. Was die eigentlichen Schweinereien der Herren DuPont, Hearst und anderer betrifft, gehen die übrigens weit über ein bißchen Drehen an der Hanf-Repressions-Schraube hinaus. Ein Forscher aus Kentucky hat ausgehend von Jack Herers Dokumentation herausgefunden, dass DuPont als glühender Rassist und Antisemit u.a. den Aufbau einer faschistischen Organisation in den USA nach Vorbild der SS (Black Legion) finanzierte und Hearst ab 1934 von Nazi-Propagandaminister Goebbels 400.000 $ pro Jahr erhielt – und der „Readers Digest“ von da an auf nazi-freundliche Berichterstattung umschwenkte. Mittenmang in diesem braunen Fan-Club waren übrigens auch der Banker George Walker, der Urgroßvater des heutigen Präsidenten George W. Bush, dem er das Dabbelju in seinem Namen verdankt, und dessen Schwiegersohn Prescott Bush. Sie ergatterten in den 30er Jahren das heutige Vermögen des Clans, vor allem durch Geschäfte mit dem aufrüstenden Hitler-Deutschland. Prescott kam 1942 vor Gericht, wegen „Dealing with the enemy“ und weil er faschistische Gruppen in den USA unterstützt hatte. Dass Walker und Bush „zu den wichtigsten amerikanischen Unterstützern Hitlers“ zählten, wie ein zeitgenössischer Journalist schrieb, bleibt in den Biographien über die Familie heute natürlich ausgespart. Und dass DuPont, der in den 30ern General Motors kontrollierte, der Nazi-Wehrmacht ihr wichtigstes Transportfahrzeug, den Opel Blitz, lieferte, kommt in den Firmen-Biographien des weltgrößten Chemiekonzerns heute natürlich auch nicht mehr vor. Die Autos für den Blitzkrieg hätten ohne Treibstoff freilich nicht rollen können, deshalb verkaufte DuPont auch noch das Patent für die Gewinnung von „Holzgas“, also die Gewinnung von Treibstoff aus nachwachsenden und fossilen Rohstoffen, an die Nazis. Für die USA hatten die Ölbarone DuPont vor einer Nutzung dieses Patents gewarnt, es hätte Wettbewerb für ihren Sprit aus Öl bedeutet, aber Hitlers Wehrmacht durfte er damit ins Rollen bringen. „Holzgas“ wird im übrigen auch in der „Lustigen Hanffibel“ von 1942 erwähnt – inwieweit damals konkrete Versuche mit Hanf als Energiepflanze gemacht wurden, versuche ich gerade herauszubekommen.
HanfBlatt: Welche Visionen hast Du für eine Zukunft mit Hanf?
Bröckers: Wie schon gesagt glaube ich, dass ein Cannabis-Friede der Anfang vom Ende des Drogenkriegs sein wird. Dass wir das Problem mit Drogen, Sucht und Elend nicht durch Krieg in den Griff bekommen, dass der Kampf gegen Drogen mehr Probleme verursacht als löst – diese Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch, auch in konservativen Kreisen. Und doch fällt es der Gesellschaft natürlich schwer, erstmal Ja zu sagen zu Drogen, den Dämon sozusagen zu umarmen, seine Anwesenheit und Notwendigkeit zu akzeptieren – doch nur so kann er seinen Schrecken verlieren. Das heißt nicht, dass nicht auch dann noch Menschen Probleme damit bekommen – von 100 Bewohnern im globalen Dorf werden immer 3 oder 4 schwere Sucht und Abhängigkeiten entwickeln und weitere 3 oder 4% sind möglicherweise gefährdet, aber für die restlichen über 92% überwiegen die Vorteile bei weitem die Nachteile – egal um welche Substanz es sich handelt. Beim Hanf ist das von allen illegalen Drogen am leichtesten einzusehen – und deshalb denke ich, dass hier in den nächsten Jahren eine Wende erfolgen wird. Die Schweiz könnte als Laboratorium einmal mehr Vorreiter sein. Was die deutschen Gesetze betrifft, hoffe ich, in meinem Rechtsstreit um den Verkauf von Vogelfutter im HanfHaus vielleicht ein bißchen an dem 1998 ergangenen Samenverbot rütteln zu können. Vorerst steht da für mich aber erstmal das Gegenteil – 17 Monate auf Bewährung – im Raum. Die nächste Instanz wird voraussichtlich erst kommendes Jahr stattfinden. Falls sich bis dahin Rot-Grün zu einem Hauch von Reform aufrafft, oder zumindest einer Ankündigung derselben, könnte das der Wahrhheitsfindung des Gerichts sicher dienlich sein. Mit einer Entkriminalsierung des Besitzes und der Erlaubnis zum Anbau für den Eigenbedarf werden 90.000 von den 94.000 Justizverfahren, die im Jahr 2000 in Sachen Cannabis Kosten verursachten, überflüssig. Das wäre ein erster sinnvoller Schritt. Und was die Nutzung von Hanf als Rohstoff angeht, ist meiner Meinung nach ein besonderes Wiedergutmachungsprogramm nötig, sprich Zusatz-Förderung für Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Hanf als Rohstoff. In das große Bio-Anbau-Programm, dass Renate Künast annonciert hat, passt Hanf ja wie der Faust aufs Gretchen….
HanfBlatt: Arbeitest Du an irgendwelchen konkreten Projekten?
Bröckers: Als aktiver Geschäftsführer des HanfHauses bin ich in diesem Sommer ausgestiegen – aber als Berater und Gesellschafter weiter an Bord. Ich werde in Zukunft wieder mehr schreiben. Gerade ist die Taschenbuchausgabe meines letzten Buchs über das Übernatürliche erschienen („Können Tomaten träumen?“ – Königsfurt-Verlag), und die da ventilierten Themen – Kosmologie, Quantenphysik, Katastrophentheorie, Bewußtseinsforschung usw. – beschäftigen mich weiter. Auch das Thema Verschwörungen. Und natürlich Hanf. Ich suche gerade nach Finanzierung für einen asketisch-luxuriösen, hanfgebundenen Fotoband – Mäzene bitte melden! Ja, und dann gibt es ein noch nicht ganz konkretes Projekt, das ich deshalb auch noch nicht ausplaudern kann, von dem ich mir aber viel verspreche. Es könnte einen ähnlichen Kick auslösen wie es das gelbe Buch in Deutschland getan hat – aber auf globaler Ebene. Es gibt immer noch viel zu tun – pflanzen wirs an!
Von oder mit Mathias Bröckers sind unter anderem der Bildband „Cannabis“ und natürlich das hier besprochene Buch von Jack Herer erschienen . Leicht zu bestellen über Amazon, neu oder gebraucht: