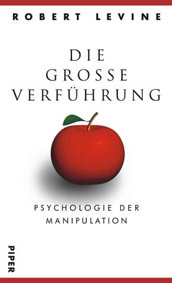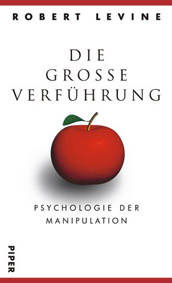telepolis v. 30.01.2003
Auch erschienen in „Medien und Erziehung“ 3/2003
Keep It Simple and Stupid
Die allermeisten Seiten im Netz sind für Behinderte schlecht nutzbar. Die Bundesregierung und das W3C wollen dies ändern. Folgt die Wirtschaft?
Wem ist es noch nicht passiert, dass er beim Navigieren den falschen Verweis geklickt hat, weil die Links zu eng gesetzt waren? Das bunte Gewimmel auf Webseiten irritiert oft schon den Otto-Normal-Surfer mächtig. Für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung ist die Navigation auf den meisten Seiten dagegen eine verzwickte Angelegenheit, wenn nicht gar eine Zumutung.
Die zahlreichen Initiativen wie „Schulen ans Netz“, aber auch die staatlichen Anstrengungen des elektronisch gestützten Bürgerservice, wie e-voting und Ausweisverlängerung drohen ins Leere zu laufen, wenn behinderte oder alte Bürger vor technischen Barrieren stehen, welche die Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte und -pflichten zum virtuellen Abenteuer macht.

Seit Juni 2002 ist nun eine Verordnung in Kraft, das alle staatlichen Einrichtungen und Behörden dazu verpflichtet bis 2005 ihre alten Internet-Auftritte so zu gestalten, dass sich wirklich jedermann darin zurecht findet. Mehr noch – gänzlich neu erstellte Amtsseiten müssen ab sofort sauber programmiert werden. Das Werk mit dem holprigen Namen „Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung“ ( BITV) legt fest, ab wann sich eine Homepage „barrierefrei“ nennen darf und orientiert sich dabei an den Richtlinien der WAI (Web Accessibility Initiative).
Schnörkelloses HTML
Diese Arbeitsgruppe des World Wide Web Consortiums (W3C) bemüht sich um die technische Funktionalität und Universalität des Internet. Mit den Richtlinien liegen seit geraumer Zeit genaue Spezifikationen vor, wie der html-Code einer Webseite barrierefrei gestaltet werden kann – nur richten tut sich kaum ein Unternehmen danach. Der Bundestag hatte deshalb im ebenfalls im letzten Jahr verabschiedeten Behindertengleichstellungsgesetz ein Schmankerl für die gebeutelte deutsche Internet-Ökonomie parat. Zukünftig wolle man darauf hinwirken, dass auch „gewerbsmäßige Anbieter von Internetseiten“ diese barrierefrei gestalten. Keine schlechte, aber wohl diffuse Idee in Zeiten des Masseneinsatzes von Flash und Java-Skript.
Die konkrete Struktur einer barrierefreien Homepage baut auf schnörkelloses HTML. KISS heisst die Aufforderung: Keep It Simple and Stupid. Mouse-over Aktionen zum Anheben oder Absenken von Buttons sind nach den Regeln der WAI ebenso zu unterlassen wie Imagemaps ohne redundanten Textlink. Zu einem Bild gehört stets ein „alt“-tag in den Code, in welchem der Inhalt des Bildes beschrieben wird. Ein Problem: Software wie Microsofts Frontpage blähen selbst kleine Homepages schon ohne aktive Inhalte zu wahren Code-Monstern auf.
Die WAI hat eine Checkliste herausgegeben, anhand derer man überprüfen kann, wie barrierefreies HTML programmiert sein kann. Tools wie Bobby prüfen, ob die eigenen Webseiten behindertengerecht sind. Das WAI-Regelwerk zielt vor allem auf Surf-Erleichterungen für sehbehinderte und blinde Mitbürger. Diese nutzen zumeist einen Screenreader wie beispielsweise JAWS, der die Informationen der Webseite aus dem HTML-Code extrahiert und über den Lautsprecher ausgibt. Seiten, die vor Java-Script strotzen, sind für Blinde daher wertlos. Aber auch nur Sehbehinderte stehen vor großen Problemen beim Surfen, wie der online verfügbare Sehbehinderungs-Simulator beeindruckend zeigt.
Nur wenige Webseiten sind bislang behindertengerecht gestaltet
Wolfgang Schneider von der Schweizerischen Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung weist darauf hin, dass die meisten Behinderungen mit einer Mobilitätseinschränkung einher gehen. „Das Internet ist daher nicht nur Informationsquelle Nummer Eins, sondern gibt mir auch die Möglichkeit, Einkäufe online zu erledigen. Und alles, was ich von zu Hause tun kann, bedeutet einen Mehrgewinn an Selbstständigkeit.“ Fest steht bislang, dass eine einfach zu handhabende und logisch aufgebaute Navigation nicht nur für Blinde, sondern für alle Besucher einer Webseite ein Gewinn, zudem weniger pflegeintensiv ist.
Rund acht Prozent der Bundesbürger sind bei den Versorgungsämtern als schwerbehindert gemeldet. Das diese nicht nur Bürger mit gleichen Rechten, sondern auch Kunden sind, darauf stößt der e-commerce erst langsam. Nach Ansicht von Detlef Girke vom gemeinnützigen Projekt BIK (Barrierefrei Informieren und Kommunizieren) sind „nur zwischen fünf und zehn Prozent der deutschen Webseiten so programmiert, dass man das Gefühl hat, dass sich dort ein Mensch darüber Gedanken gemacht hat, ob eventuell auch mal ein behinderter Mitbürger vorbei gesurft kommt.“
Selbst in einem für Behinderte sensiblen Bereich wie dem Gesundheitswesen sind über 80 Prozent der Informationsangebote nicht barrierefrei. Weniger Achtlosigkeit als vielmehr technische Probleme hielten die Unternehmen aber von behindertengerechten Design ab. Oft, so Girke, macht die hinter den Seiten liegende Datenbank ein barrierefreien Auftritt unmöglich. Die Lösung liegt oft nur in einem kompletten Umprogrammierung der Seiten und der Datenbank – ein Schritt, den die meisten Unternehmen aus Kostengründen scheuen.
Mittlerweile nimmt sich auch die EU der benachteiligten Menschen im Informationszeitalter an. Sie rief 2003 zum Jahr der Menschen mit Behinderungen aus. Das Thema „Barrierefreiheit“ ist ein Schwerpunkt auf der zugehörigen Agenda.