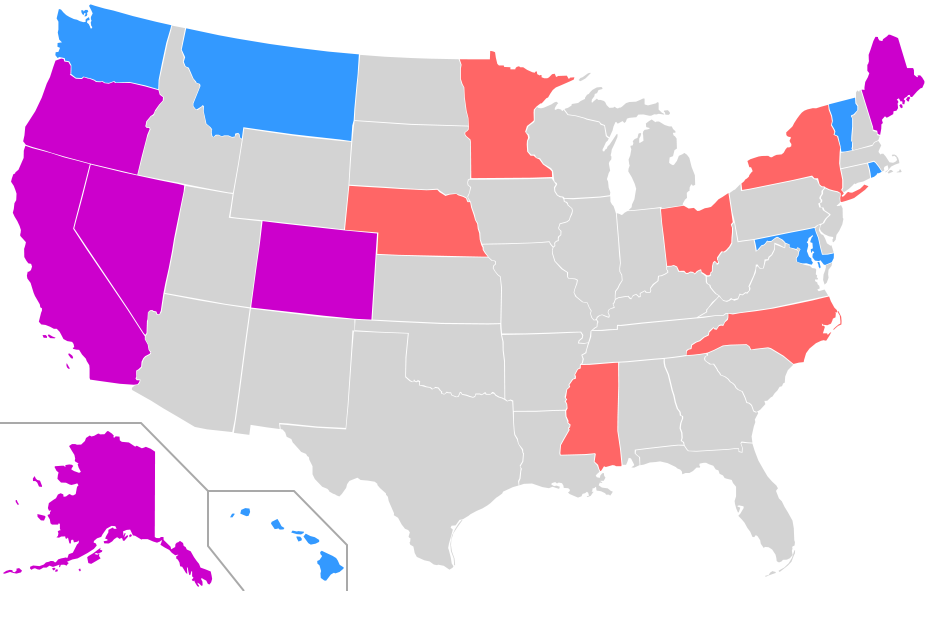Aktualisierte Version April 2019. Eine alte Version schwirrt im Netz herum. Eine bitte an die vielen Kopierfreudigen: Bitte kopiert diesen neuen Text nicht und setzt ihn bitte nicht auf eure oder irgendeine Webseite. Eine Verlinkung soll reichen. Wer ihn abdrucken oder anderweitig veröffentlichen will, der wende sich bitte an mich, ich leite das dann weiter. Danke.
2001 publiziert, updated 2019, copyright nach wie vor by Achim Zubke (az)
Theoretisch kann überall auf der Welt, wo psychoaktiver Hanf gedeiht, auch Haschisch (Cannabisharz) gewonnen werden. In bestimmten Ländern hatte sich allerdings traditionell oder in Folge internationaler Nachfrage eine Hanfanbaukultur speziell zum Zwecke der Haschischgewinnung etabliert. Dementspechend bestimmten ihre Produkte den Markt. Allein in der Bundesrepublik Deutschland wurde der Umsatz von Cannabisprodukten, das hieß bis Ende des 20. Jahrhunderts noch vor allem Haschisch, auf jährlich 400 bis zu 900 Tonnen geschätzt. In Folge des Anfang der 1990er Jahre beginnenden Anbau-Booms hochpotenter Hybrid-Keuzungen vor Allem indoors unter Kunstlicht und kontrollierten Bedingungen zunächst in Holland, vorübergehend in der Schweiz, schließlich auch in Deutschland, Österreich, Tschechien und Belgien dominieren Sinsemilla-Hanfblüten mittlerweile den Markt. Aus bei deren Produktion anfallenden noch harzreichen Blüten- und Blattresten werden durch Siebung wie z.B. mit dem automatischen Trommelsieb („Pollinator“), durch Eiswasserfilterung („Ice-o-later-Bags“, „Bubble-Bags“), Trockeneis-Siebung und dergleichen auch begehrte Haschisch-Produkte gewonnen. In den letzten Jahren erlebt allerdings die nicht ungefährliche Gewinnung von zum Inhalieren mittels Verdampfung („Dabben“) geeigneten konzentrierten Extrakten, insbesondere mit Hilfe von Flüssig-Butangas („Honeybee-Extraction“, „BHO“) und Flüssig-Dimethyläther („DME“) aber auch anderen Lösungsmitteln (professionell analog zur Hopfen-Extraktion mit Flüssig-Kohlendioxid) einen Boom. Wo Überfluss herrscht, werden auch die Blüten selbst zur Haschisch- und Extraktgewinnung eingesetzt. Dennoch gibt es unter Cannasseuren immer noch eine Nachfrage nach exotischem importiertem „Oldschool“-Haschisch. In den Anbauländern reagiert man auf die veränderte Nachfrage durch Einführung ertragreicherer und potenterer internationaler Hybrid-Kreuzungssorten und die Einführung neuerer Haschisch-Gewinnungstechniken (Siebungsmethoden, Ice-O-later-Technik) und Ölextraktionen. Weil Haschisch ein Naturprodukt ist, gab und gibt es ähnlich wie bei Wein eine unbegrenzte Vielfalt schwankender Qualitäten.
Da leider keine flächendeckenden zuverlässigen wissenschaftlich fundierten Produktanalysen und Herstellungsbeschreibungen für die Verbraucher vorliegen, soll sich dieser Artikel sozusagen spielerisch, auszugsweise und ohne jede Verbindlichkeit der Produktvielfalt in Form eines kleinen, eher anekdotisch zu verstehenden Lexikons annähern. Namensdeklarationen bieten unter Schwarzmarktbedingungen keinerlei Gewähr, dass das angepriesene Produkt auch den Phantasievorstellungen des Käufers entspricht. Um die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, sei hier nochmals eine auf Qualitätskontrolle beruhende Verbraucherberatung in punkto psychoaktiver Hanfprodukte gefordert und Legalisierung, versteht sich von selbst.
Diese Liste soll auf keinen Fall als Anregung zum Kauf oder Konsum von nach wie vor verbotenen Cannabisprodukten missverstanden werden. Es handelt sich lediglich um ein im Kern auf zahlreichen anonymen Quellen basierendes journalistisches Zeugnis realer oder imaginierter Verhältnisse.
MAROKKO
Trotz Konkurrenz durch den in Europa mittlerweile weit verbreiteten Indoor-Marijuana-Anbau von Hybrid-Kreuzungen unter künstlichen Bedingungen ist Marokko immer noch der Hauptlieferant von großen Haschisch-Mengen für den westeuropäischen Markt. Auf Grund der Größe der Anbauregionen, der Vielfalt der Anbauflächen und -techniken, zusätzlich eingebrachten Saatguts und neuer Produktionsmethoden ist das Land mit einer kaum überschaubaren Produktpalette am Start. Typischerweise kam und kommt Marokkaner als durch Siebung gewonnene und mechanisch gepresste harte gelblichbraune Platten („Grüner“, „Platte“, „Brick“) in Westeuropa auf den Markt. Seit einigen Jahren werden auch runde 100 Gramm-Platten und 200 Gramm-Bälle gehandelt. In Großbritannien ist bis heute der ca. 250 Gramm schwere „Soap-Bar“ in Seifenform beliebt. Kleinschmuggler bringen oft Verdauungstrakt-kompatible 10 Gramm-Pellets aus hochwertigem Haschisch mit. Hatte man früher „Ki(e)f“ (Fruchtstände) für das traditionelle Rauchen in langstieligen Sebsi-Pfeifen angebaut, begann man in den 1960er-Jahren mit der Haschisch-Gewinnung für den internationalen Markt. Die Produktion hatte sich seit Ende der Sechziger Jahre bis ins 21. Jahrhundert kontinuierlich gesteigert. 2003 erreichte sie ein Anbauflächen- und Produktionsmaximum. Aus dem traditionellen Anbaugebiet im zentralen Rif-Gebirge (Chefchaouen-Provinz mit dem Zentrum Ketama und Teilen von Al Hoceima) hatte sie sich in die Nachbarprovinzen Larache und Taounate ausgedehnt. Dort erfolgten in Folge von UN-Berichten 2005 staatliche Repressionsmaßnahmen. Das Haschisch aus diesen Regionen galt ohnehin als minderwertiger. Die Produktion in den zentralen Anbaugebieten wurde darauf hin durch die massive Einführung internationaler Hybrid-Kreuzungen und den Ausbau künstlicher Bewässerung in Menge und Qualität erheblich gesteigert und soll nach wie vor insgesamt im vierstelligen Tonnenbereich liegen.
„Zero Zero“(sprich „Siero Siero“), „00“ oder „Double-0“
ist reines Haschisch aus dem Harzdrüsenkopfpulver der feinen und vorsichtig durchgeführten ersten Siebung. Seine Potenz ist hoch, intensiv stimulierend bis psychedelisch, nicht allzu lange anhaltend, ohne zu sehr zu ermüden. „Zero Zero“ ist oft nur leicht gepresst, aber dennoch kompakt, geht gut auf, lecker aromatisch, ein echtes Naturprodukt. Es brennt relativ schnell weg. „Zero Zero“ hat sich in Kifferkreisen einen guten Ruf erworben. Der Name kommt vom Feinheitsgrad des verwendeten Siebes aus Seidentuch, das über eine Schüssel gespannt wird und durch das das feine Harzdrüsenkopf-Pulver bei nur leichter Erschütterung rieseln muss. Das goldbraune ungepresste „Zero Zero“-Pulver lässt sich auch ungepresst gut rauchen, ist wegen seines Volumens und der Schwierigkeit, es zu schmuggeln, aber nur sehr selten im Handel. Die ungepressten Drüsenköpfe konservieren Wirk- und Aromastoffe übrigens oft besser als das daraus gepresste Haschisch. Deshalb lagern viele Produzenten Haschisch-Pulver und pressen es erst für den Versand in die gewünschte Form. Dies bietet auch die Option auf die Kundschaft angepasste Mischungen oder Streckungen vorzunehmen.
„Tblisa Hash“
auch Twesla, Twizla, Tbizla, Tibizla, Tbizla, Tabizla usw. wird ein exzellentes Haschisch vom Typ „Zero Zero“ genannt, bei dem theoretisch nur das Harzpulver verwendet werden soll, das bei der ersten Siebung auf ein in die Mitte der unter dem Siebtuch befindlichen Schüssel gelegtes kleines Brett gerieselt sei. Diese Bezeichnung wird generell für fein gesiebtes Kleinschmugglerhasch hoher Qualität verwendet und verbreitete sich in den 1990er Jahren.
„Double Zero Zero“, „Double 00“ oder „0000“
ist die Bezeichnung für eine goldgelbe Sondersiebung, die nur in sehr kleinen Mengen auf Nachfrage in Marokko angefertigt wird. Ausgewählte Pflanzen werden extrem vorsichtig gesiebt, so dass wirklich möglichst nur noch die harzhaltigen Drüsenköpfe und kaum Zystolithenhaare, Pflanzenteile und Staub durchrieseln. Dieses exzellente Haschisch ist erheblich teurer und erreicht fast nie den offenen (Schwarz-)Markt. Um besonders hohe bzw. feine Siebungsgrade und Qualitäten anzudeuten wird bei der Vermarktung gern mit Nullen gespielt. So wird auch „Triple Zero“ angeboten.
„Zero“ oder „0“
bezeichnet die 2. Siebung durch ein etwas grober gewebtes Stoffsieb der Maschengrösse „0“. Es enthält deutlich auch nicht psychoaktive Blütenteile, insbesondere Zystolithenhaare und ist nicht ganz so potent. Da es aber nicht gestreckt worden ist, bietet es die von vielen Kiffern als positiv eingeschätzten Eigenschaften eines natürlichen konzentrierten marokkanischen Hanfproduktes zu einem verhältnismässig günstigen Preis. „Zero“ ist schon stärker gepresst, angeblich durch Schlagpressung, kann aber meist schon von Hand gebröselt werden.
„Casablanca“
benannt nach der größten Stadt Marokkos, handelt es sich um einen guten Marokkaner vom Typ „Zero“ mit klarer anregender psychedelisch-euphorisierender Wirkung, der in Tee gebröselt ein scharfes ingwerartiges Aroma aufweist. Die Cannabinoide und Terpene in den Hanfblütenständen und im Haschisch haben im Übrigen ohnehin intensive aromatische Gewürzeigenschaften und werden deshalb seit vielen Jahrhunderten auch aus kulinarischen Gründen in diversen Getränken, Süßigkeiten und Speisen genutzt. Casablanca ist eine moderne Hafenstadt, ein Geldwäschezentrum für den Haschisch-Großhandel und steht atmosphärisch für einen schwülstigen Spionagefilm mit Humphrey Bogart.
„Special Casablanca“
soll ein erstklassiger Marokk vom Typ „Casablanca“ genannt werden, der nach Eukalyptusbäumen und Pinien riecht.
„Sputnik“
steht für Haschisch von ausgezeichneter Qualität, das Anfang der 1980er Jahre Berühmtheit erlangte. Leider entspricht ebenso wie bei anderen Sorten nicht alles, was auf dem Schwarzmarkt unter einem wohlklingenden Namen angeboten wird auch dem, als was es angepriesen wird. „Sputnik“ ist dunkelbraun, sehr drüsenhaltig und entsprechend harzig, wirkt dabei dennoch etwas grob und schwer. Die Potenz ist sehr hoch, das High tief, anhaltend und psychedelisch, abgerundet mit einer ausgeprägten körperlichen Note. Es soll aus der ersten Siebung von ausgewählten in höheren felsigen und wilden Lagen des Rifgebirges gewachsenen Pflanzen gepresst sein. Der Name kommt vielleicht daher, dass es abgeht wie eine Sputnikrakete.
„Chocolata“
ist die Bezeichnung für eine Spezialität, die so begehrt und exklusiv ist, dass sie zum Grossteil schon in Marokko verbraucht wird. Es handelt sich um grünschwarzes von Hand verarbeitetes und nicht nachgepresstes Haschisch, das angeblich noch vor der eigentlichen Ernte von noch auf dem Feld stehenden Pflanzen gewonnen wird. In den Handel kommt dieses Leckerli in Mengen von maximal 20 bis 50 Gramm in typischen kleinen runden Dosen. Hier gilt die Regel, je kleiner die Handelsmenge, desto besser und edler das Haschisch. „Chocolata“ hat einen Ruf als delikates und hochpotentes „Guten Abend-Dope“.
„Black Maroc“ oder „Schwarzer Marokk“
ist üblicherweise ein sehr potentes Haschisch, das den Sorten aus dem mittleren Osten ähnelt. Es riecht minzig-ungewöhnlich. Seine Wirkung kommt mit Verzögerungseffekt, „hinterhältig“, ziemlich psychedelisch, was auch immer man darunter versteht. Es erreicht gelegentlich den spanischen oder gar den mitteleuropäischen Markt, aber immer nur in geringen Mengen. „Black Maroc“ und andere herausragende marokkanische Sorten können unter Mühen von Hand umgepresst werden. Spätestens dann nimmt das Haschisch eine braunschwarze Farbe an. Dunkle Farben allein sind allerdings keine Gewähr für Qualität. Sie können auch von Zusatzstoffen herrühren. Der „Schwarze Marokk“ soll von Pflanzen mit afghanischem oder pakistanischem Erbgut (der Himalaya-Raum war gerüchteweise auch im Gespräch) gewonnen werden, deren Blütenstände vor der Weiterverarbeitung fermentiert wurden. Wahrscheinlich wurde das Haschisch von Hand vor- und dann maschinell nachgepresst. Wie dem auch sei, gerade auch in Marokko verändert sich die Palette des hergestellten Haschisch mittlerweile laufend durch neues von Händlern eingebrachtes internationales Saatgut und „neue“ Verarbeitungsmethoden.
„Gardella“
Offensichtlich in verschiedenen Qualitätsstufen (wahrscheinlich Siebungen) vorkommender eher durchschnittlicher heller („wie gelber Libanese“) bis dunkler „schwarzer“ Maroc, deren Ausgangspflanzen von Saatgut abstammen sollen, das aus Pakistan, wahlweise Afghanistan (dagegen spricht ein für Maroc durchschnittlicher CBD-Gehalt in analysiserten Proben) oder (auf Grund der dortigen tendenziell wenig buschigen hochwüchsigen Pflanzen eher unwahrscheinlich) Nordindien (Manali) eingeführt worden sei. Eventuell soll es sich um Hybriden dieser Pflanzen mit traditionellem marokkanischen Haschischpflanzen handeln.
„Afghane“, „Pakistani“, „Araber“, „Jamaicaner“, „Mexikaner“, „Kashmiri“ und so weiter
Tatsächlich wurde im Rif-Gebirge seit Anfang der 1990er Jahre zunehmend und in großem Stil Haschisch aus Hanfpflanzen mit einer Genetik pakistanisch-afghanischer Herkunft angebaut. Es ist unklar, ob das Saatgut für diese Pflanzen tatsächlich aus dieser Region oder Europa (Schweiz?) stammte. Während die traditionellen Haschisch-Sorten von marokkanischer Kif-Hanf-Genetik je nach Höhenlage und Bewässerung meistens bereits ab Juli bis August geerntet werden können, folgten die neuen in der Regel künstlich bewässerten „Indicas“ oft erst später, bis September oder gar Oktober mit entsprechenden Problemen bei der Trocknung. Das Haschisch, das traditionell erst in der kalten Jahreszeit im Herbst und Winter gesiebt („getrommelt“) wird, war aus diesen Pflanzen gewonnen tendenziell dunkler, harziger, knetbarer, weniger stimulierend und erhebend wie nun schon klassischer THC-dominanter Maroc, aber potent. Man sprach von „Afghane“ oder „Pakistani“. Zunehmend kam es durch Kreuzung oder Pollenflug zu genetischen Mischbeständen, die nun eine neue Vielfalt von Produkten mit entsprechenden Fantasienamen wie zum Beispiel „Scheherazade“ und vielen anderen liefern.
Auch aus anderen Ländern bzw. von der genetischen Herkunft auf diese bezogen, sollen große Mengen Saatguts für neue experimentelle Felder angeschafft worden sein. Bezüglich des daraus gewonnenen Haschisch sprach man von „Jamaikaner“ (vermutlich von Hybrid-Kreuzungen auf Basis der international anerkannten und begehrten Skunk-Haze-etc.-Richtung), „Mexikaner“ (soll „sativa“-dominant sein), „Araber“ (vermutlich Saatgut aus dem Libanon, dass auch schon in der Vergangenheit in den regionalen Kif-Pflanzen-Bestand eingebracht worden sein soll), das keinen besonderen Ruf genießt (zwar harzhaltig, aber wenig potent und CBD-dominant), und „Kaschmir“ (soll „indica“-dominant sein).
In den letzten Jahren hat es einen erneuten drastischen Wechsel gegeben. Verschiedene aus Europa eingeführte internationale Hybrid-Sorten werden mit Hilfe künstlicher Bewässerung großräumig angebaut. Hier ist in Zukunft mehr Produktvielfalt zu erwarten. In den Laboranalysen der Verfolgungsbehörden spiegelt sich die Entwicklung in häufig recht hohen THC-Gehalten von um die 16 bis 20 % und mit Spitzenwerten noch weit darüber hinaus. Während bei Massenware lediglich im Schnitt 8 % gemessen wurden.
Gesiebtes Haschisch von in Marokko outdoors gezogenen internationalen Hybrid-Kreuzungen wird unter wohlklingenden Namen wie zum Beispiel „Shiraz“ angeboten.
„Bubble Marokk“ bezeichnet mit der „Ice-o-later“-Technik gewonnenes Haschisch, welches zunehmend Freunde findet. Der „Ice Marokk“ findet sich mittlerweile regelmäßig auf Amsterdamer Coffeeshop-Menues am oberen Ende der Preisskala für Marokk, in der Regel (aber nicht notwendigerweise) günstiger als die hochpreisigen „lokal“ produzierten niederländischen „Ice-O-lator“-Produkte.
Bei „Triple X“ soll es sich ebenfalls um ein mit dieser Technik gewonnenes Produkt handeln.
„Rifman-Haschisch“, und „Block-Haschisch“. Von holländischen Hybrid-Kreuzungen unter holländischer Anleitung mit nach eigenen Angaben höheren Qualitätsstandards als vor Ort üblich in Marokko auf traditionellen Outdoor-Anbauflächen gewonnene Haschisch-Sorten vom Typ „Zero Zero“ in auf Grund der Ausgangspflanzen und des Anbauortes (Terroir) interessanten unterschiedlichen Qualitäten werden unter diversen Namen von professionellen Anbietern über niederländische Coffeeshops vertrieben. Typisch sind relativ hoher THC bei niedrigem CBD-Gehalt. „Rifman“ (mit Sortennamen wie „Noor“, „Malika“, „Habibi“, „Nadira“, „Laila“ etc.) und „Block“ (von „Amsterdam Genetics“/“The Block Doc“ mit jeweils nach der Ausgangs-Gras-Sorte benanntem „Block“-Hasch) sind Markennamen ihrer Händler die die Qualität ihrer Produkte garantieren sollen.
Hier besteht aktuell auf vielen Ebenen erhebliches Veränderungspotential. Mehr Grower werden in Zukunft unter dem Druck der Konkurrenz ihre Erträge und die Potenz und Qualität ihrer Produkte deutlich steigern wollen, ebenso durch zusätzliche Varianten bei der Methodik der Harzgewinnung und der in Marokko ohnehin schon lange praktizierten Extraktion zur Gewinnung von Ölkonzentraten, die wiederum zur Mischung neuer Haschischprodukte geeignet sind. Allerdings kommen auch weiterhin minderwertige z.B. mit (Hanf-)Pflanzenpulver gestreckte „locker aufgehende“ und mit flüssigen Zuckerkonzentraten und anderen Streckmitteln vermischte „blubbernde“ Produkte auf den Markt.
„Agadir“
Benannt nach der Hafenstadt, die auch ein Touristen- und Export-Zentrum ist. Hierbei soll es sich um dunkles Haschisch mit einer fast afghanischen Geschmeidigkeit, gutem Geschmack und von guter Potenz handeln. „Etwas für Marokkliebhaber. Alles wird interessant.“
„Kugeln“, in Holland „Echte puntjes“
ist ein potentes, sehr dröhniges Haschisch, das in bei Wärme mit der Hand knetbaren Kugeln kommt; eine Spezialität, die angeblich nur von einer (Gross-)Familie hergestellt wird. Ein ähnliches Produkt aus gesiebtem Haschisch wird in Holland auf Grund der Knetbarkeit unter der Bezeichnung „Warme Oor“ („Warm Ears“) gehandelt.
„Sahara-Sand“ oder „Sahara“
ist ein sehr gutes „leichtes Tageshasch“, das high macht, ohne zu sehr zu erschöpfen. Es ist voluminös, da es nur ganz leicht gepresst ist, angeblich durch Eigengewicht, sogenannte Lagerpressung. Es kann ohne Erhitzen zerbröselt werden, fühlt sich sandig an und hat auch eine Farbe gelb wie heller Wüstensand. Keine Streckmittel verderben den relativ milden Geschmack. „Sahara“ ist ein Haschisch vom Typ „Polle“, das von Kennern gern als „königlich“ bezeichnet wird.
„Polle“, „Pollen“ oder „Polm“
ist eine Bezeichnung, die ursprünglich von Europäern für ein ungepresstes Haschischpulver so fein wie die männlichen Pollen benutzt wurde. Es besteht NICHT aus den unwirksamen Pollen, sondern wie auch die anderen Haschischsorten vornehmlich aus den Harzdrüsen, die hauptsächlich von den weiblichen Blüten und den sie umgebenden Blättern stammen. „Pollen“ ist meist nicht allzu stark gepresst. Es gibt dieses Haschisch in diversen Qualitäten von „commercial“ aufwärts bis zum „Super Pollen“. Die besten Sorten sind den Zero-Qualitäten durchaus ebenbürtig.“ Besonders gutes Haschisch vom Typ „Pollen“ kommt zum Beispiel als „Kissenpolle“, gepresst zu kissenfärmigen 100 Gramm-Blöcken, oder noch besser als sogenannte „A-Qualität“ zu etwa 50 Gramm in den Handel. Hier gilt die je kleiner – je feiner – Regel (, muss aber nicht).
Als „Berber-Pollen“ wurde relativ dunkles hart gepresstes Haschisch aus dem Rif-Gebirge verkauft.
In welcher Form „Wurstpollen“ auf den Markt gelangt, darf geraten werden.
„Kif“ oder „Kief“ wird seit einigen Jahren als Bezeichnung für durch Siebung hergestelltes ungepresstes Haschischpulver unbestimmter Herkunft verwendet. In Marokko bezeichnete es ursprünglich geschnittene von Samen, Blättern und Stängeln befreite weibliche Hanffruchtstände, die vermischt mit klein geschnittenem Tabak traditionell in der kleinköpfigen und langstieligen Sebsi-Pfeife geraucht werden. THC-dominante Kif-Hanfpflanzen wurden erst ab den 1960ern zur Haschischgewinnung eingesetzt, möglicherweise (teilweise) hybridisiert mit importiertem Haschisch-Hanf-Saatgut aus dem Libanon. Heute bezeichnet Kif manchmal auch gepresstes Haschisch. Von Kif leiten sich die geläufigen Begriffe „kiffen“ und „Kiffer*in“ ab. „Keif“ bezeichnet in Nordafrika einen entspannten „gechillten“ Zustand.
„King Mohammed“ (V)
Als „King Mohammed“ wird ein hochwertiges helleres Haschisch vom Typ Super Pollen genannt. Es ehrt den Herrscher, von dem die Hanfbauern im zentralen Rif-Gebirge behaupten, er hätte ihnen zu Beginn der marokkanischen Unabhängigkeit 1954 den Cannabis-Anbau zumindest mündlich erlaubt. Bei Königs hielt man sich dazu in der Öffentlichkeit allerdings stets vornehm bedeckt.
„King Hassan“ (II)
Als „King Hassan“ wird ein den 1999 verstorbenen diktatorisch herrschenden König von Marokko im Namen ehrendes dunkleres Haschisch vom Typ Superpollen verkauft. Der König habe zwar 1992 auch in Marokko den weltweit zu Verbrechen, Gewalt, Ungerechtigkeit und Gesundheitsschäden beitragenden „war on drugs“ erklärt, tatsächlich aber an der Praxis der Haschisch-Gewinnung im Rif-Gebirge nichts groß geändert. Im Gegenteil, die Geschäfte hätten in seiner Zeit geboomt.
„King Mohammed (VI) Twisla“ oder „Royal Twisla“
Der gegenwärtige König gelte bei den Berbern im Rif als cannabisfreundlich und produziere gar sein eigenes royales Haschisch. Da er nicht alles selbst rauchen könne, gelange manchmal auch etwas davon auf den europäischen Markt. Wenn die Qualität nicht stimmen sollte, hätte man hier zumindest jemanden mit Kompetenz, an den man sich mit seiner Reklamation diskret wenden könnte.
„French newspapers“, „Paper“, „French“ oder holländisch „Franse krant“
ist die gängige Bezeichnung für ein Haschisch, das in relativ dünnen Platten zu etwa 100 Gramm gehandelt wird, von denen jeweils zehn mit Zwischenlagen französischsprachigen marokkanischen Zeitungspapiers zu einem Einkilopaket zusammengepresst werden. Diese Handelsform gibt es auch mit Zwischenlagen aus Löschpapier. Wirkt dann nicht ganz so billig. Grossschmugglerhasch. In den Augen der KundInnen stimmt bei dieser Sorte in der Regel das Preis-Leistungsverhältnis und wäre von ihnen als Standard für ein „Commercial Dope“ erwünscht. Die Qualität der „Grünen Platte“ oder gar des „Eurogrünen“ ist jedoch noch erheblich geringer! (Oh Haschisch – mir graut`s vor dir!) French ist hart, relativ „fett“, bröselt leicht, wirkt entspannend und lässt sich auch über längere Zeiträume konsumieren (, wenn es denn sein muss). Wird bevorzugt im Tabak-Joint geraucht, sofern diese Unsitte nicht sowieso gängige Praxis ist.
„Puck“
hat einen eher schlechten Ruf. Es wird gemunkelt, es werde aus den am Fussboden anfallenden und zusammengekehrten pulvrigen Siebungs- und Pressresten hergestellt. Dementsprechend schwankt seine Potenz erheblich. Es handelt sich um ein dunkelbraunes Haschisch, hart und plattgedrückt wie ein Eishockeypuck, das mehr zerbröselt, als dass es aufgeht, langsam brennt und einen rauhen bis kratzigen Geschmack aufweist. „Puck“ ist mehr oder weniger übel gestreckt und wird durch Bindemittel zusammengehalten. Er kommt in dicken länglichen Blöcken um die 250 Gramm, die an den Seiten stark abgerundet sind. „Puck“ kann manchmal überraschenderweise recht potent sein. Dann wirkt er jedoch eher dröhnig, nicht gerade inspirierend oder das, was man kreativ nennen kännte, auf jeden Fall kein soziales Dope, eher der Letzte am Abend, aber auch dann kopfschmerzverdächtig (spätestens am nächsten Morgen), kurz gesagt, sein Geld nicht wert.
„Soap Bar“ und „Europlatte“
Meist in 250 Gramm-Blöcken wird nach wie vor für den britischen Markt sogenanntes „Soap Bar“-Haschisch produziert. Das Äquivalent dazu ist auf dem deutschen Markt die „Euro-“ oder „Punkerplatte“. Dieses hart gepresste, außen glänzend-dunkle, innen meist deutlich hellere, trockene oder verdächtig klebrige unter Hitze und hohem Druck gepresste Haschisch besteht im besten Fall noch aus drittklassigen Siebungen mit Zuschlag von natürlichen Färbemitteln und wird durch Bindemittel wie Baumharz zusammengehalten. Doch nicht einmal hierfür gibt es eine Garantie. Schlimmer geht immer. Hier geht es auf jeden Fall schon nicht mehr nur um Haschisch, sondern um Gesundheitsgefährdung. Die Potenz ist gering bis zu vernachlässigen. Für eine positive UK langt es allerdings meist noch. Interessant für Trinker, die als Fingerakrobaten für kleines Geld gerne rituell bröseln und beim Rauchen glühende Kohlen rieseln sehen wollen. Als Nächstes auf dem Weg nach ganz unten kommen nur noch faktische Fälschungen, manche würden sagen post-faktisches Haschisch.
„Sierra Ketama“
hiess das erste noch relativ „wilde“ Haschisch, das in den Sechziger Jahren aus Marokko auf den mitteleuropäischen Markt gelangte. Die typische Form sind flache Platten. Es wirkt ähnlich wie klassischer Türke „leicht“, psychedelisch und stimulierend. Eine Spezialität für Nostalgiker. Ketama ist der zentrale Handelsort im Zentrum der gleichnamigen Provinz und des marokkanischen Hauptanbaugebietes für Hanf zur Haschischgewinnung, welches sich über weite Teile des Rifgebirges, spanisch kurz Sierra genannt, ausdehnt.
„Ketama Gold“ oder „Dahab Ketama“
steht für eine relativ feine Siebung, aber nicht so gut wie „Zero Zero“ aus derselben Gegend. Dahab ist arabisch für „Gold“.
„Ketama“
bezeichnet ein leicht gewürztes „akzeptables Gebrauchshasch“ aus groberen Siebungen. Oft sind Schichten erkennbar. „Schichtmarokk“. Wird als anregend und aphrodisisch beschrieben.
„Azila(h)“
Kleinschmuggler, die sich vor Ort mit möglichst hochwertigem Haschisch versorgen, reisen traditionell in kleine Dörfer im Rif-Gebirge in der Umgebung vom exponierten Ketama. Azila (in der Sprache der Berberbevölkerung „Immazzouzane“) ist Eines der Bekanntesten davon. Herkunftsnamen stehen ähnlich wie beim Wein für lokale Qualitäten. Lagenangaben, Sortenkennzeichnungen, Anbaumethoden (Bio?), Erntezeitpunkte und Infos über Verarbeitunsgverfahren wären denkbar und wünschenswert. Aber welche Verbraucherzentrale wird sie zuverlässig kontrollieren?!
„Hia Hia“, „Hya“ oder „Heya“
(marokkanisch für „Leben“, ein Frauenname) riecht altertümlich nach frühen Haschischerfahrungen. Ein Hasch, von dem man still wird. Hochwertig, aber meist etwas überteuert, wenn angeboten.
„Bani“
soll auch so ein nostalgisches, in Holland bei älteren Kunden beliebtes Dope sein. Geruch und Geschmack sollen an alte Zeiten denken lassen. Ein dunkler Marokk, der ziemlich stoned macht. „Tütendope, um den Bodenkontakt wiederherzustellen.“
„Eiermarokk“ oder „Eierdope“
kam Mitte der Achtziger Jahre auf den europäischen Markt. Es handelt sich um „künstliches“ Haschisch, das in Präparierungen unterschiedlicher Konzentration aus Haschischäl (vornehmlich) marokkanischer Herkunft, und wenn man Glück hat, nur mit pflanzlichen Füllstoffen (darunter angeblich auch Hanfblattpulver) hergestellt und in verschiedenen Preislagen entsprechend der Potenz angeboten wird. Leider wird von Verunreinigungen berichtet (z.B. von Plastikfolie). Als Herstellungsorte werden Spanien („Almeria“), Holland und Deutschland genannt. Das Öl wird möglicherweise zum Teil aus beschlagnahmtem Haschisch extrahiert und erst dann exportiert, so hiess es. Das beste „Eierdope“ ist dunkel, fast schwarz, innen grünlich, und schwer, cremig, geschmeidig durch hohen Ölgehalt und verblüffend potent. Die Wirkung ist heftig, „ölig“, „Typ Sockenauszieher“ oder „Hinsetzer“. „Eiermarokk“ geht oft erstaunlich gut auf. Niedere Qualitäten sind trocken, hart und fest, können aber auch noch recht stark sein. Richtige Fans haben früher eigentlich weder Haschöl noch „Eiermarokk“ gewinnen können. Die Wirkung ist vielleicht zu „raffiniert“. Der Name bezieht sich auf eine typische Handelsform, also Pressung in Eiform.
„Caramellos“
ist eine weitere meist hochpotente Zubereitungsform mit „öligem“ Geschmack und High. Es handelt sich dabei um runde längliche Stäbchen von aussen dunkelbrauner bis ölig-schwarzer und im Schnitt grünlichbrauner Farbe mit cremiger karamellartiger Konsistenz. Es wird gesagt, dass es sich bei diesem als typischem Kleinschmugglerhasch verhältnismässig überteuert angebotenem Produkt um handgerolltes „echtes“ marokkanisches Haschisch handle, das eine Zeit lang in Haschischöl eingelegt und erst dann abgepackt wurde.
Die zylindrische kötelartige Form der „Caramellos“ ist mittlerweile seit Jahren eine Standardform für feines harziges sehr fest gepresstes Haschisch in der Regel guter bis sehr guter Qualität („Blubberhasch“), das in Plastikfolie eingewickelt und von ambitionierten Kleinschmugglern geschluckt durch den Magendarmtrakt wandern muss, bevor es den Verbraucher erreicht. Waren Verpackung und Flug-Diät suboptimal, spricht man anlässlich des angenommenen Skatol-Geruchs wie einst die Spezis vom Rauschgiftdezi von „Shit“, was schon immer Alarmsignale ausgelöst hat.
„Commercial“
meint diverse in harte, trockene Platten gepresste Mischungen der groben Siebungsgrade, meist ab dritter Siebung abwärts, mit hohem Anteil an Pflanzenteilen, oft mit Zusatzstoffen (Füll- und Farbstoffen, Gewürzen, Konsistenzverbesserern, Trieb- und Bindemitteln) vermengt; schwer zu rauchen, kratzig mit schwachem nicht besonders ausgeprägtem Törn; fällt unter die Kategorie dessen, was verächtlich „Grüne Platte“ oder „Europlatte“ genannt wird; dominierte den bundesdeutschen Markt Mitte bis Ende der Achtziger Jahre; wird angeblich zum Teil erst z.B. in den Niederlanden aus importiertem Haschpulver verschiedener Provinienzen (Marokko, Libanon) auf Nachfrage zubereitet und geliefert. Hierbei ist zu bedenken, dass Haschisch aus dem Libanon mittlerweile Raritätenstatus genießt.
In der traditionellen kommerziellen Haschischgewinnung für den Großhandel unterschied man in Marokko im Übrigen nur grob drei Siebungsqualitäten. Das nicht besonders THC-haltige getrocknete Pflanzenmaterial der traditionellen Sorten nannte man dabei „Kif“, das daraus gesiebte goldbraune Pulver der ersten Siebung „Sigirma“, das Grünliche aus der deutlich schwächeren 2. Siebung „Hamda“. Die 3. Siebung wurde zum Strecken verwendet. Der Ertrag lag im Schnitt bei jeweils 1 Kilogramm pro 100kg „Kif“.
Weitere Bezeichnungen für marokkanisches Haschisch bezogen auf die Qualität sind „Normal“, „Medium“, „Mittelklasse“, „Specialklasse“, „Superklasse“, „Primo“ und „Premier“. Bezeichnungen wie „Honigmarock“ oder „Blümchenmarock“ heben auf Eigenschaften wie Farbe, Konsistenz und Geruch ab und deuten teure und potente Qualitäten an.
„Madelaine“ hiess eine kommerzielle Sorte, die in Verpackungsfolien für französische Kleinkuchen (einer pleitegegangenen Firma) auf den Markt kam.
„Chirac Royal“ ist zwar ein ironischer Name für ein Haschisch. Es soll aber nicht so explosiv wie die Atombomben dieses beschränkten Hardliners gewesen sein.
„Golden Soles“ soll seinen Namen von der (Schuh-) Sohlenform haben, in die das Haschisch (eventuell zum Schmuggel) gepresst wurde.
„Nogaa“ („der Kern“) oder auch „Fatima“, „Malika“, „Leila“, „Noor“ „Shera“ und viele viele mehr sind marokkanisch anmutende Namen, wie sie einem in holländischen Coffeshops über den Weg laufen können (siehe auch „Rifman-Haschsich“). Jeder Händler denkt sich für seine Produkte eigene Namen aus. Wenn sie tatsächlich zuverlässig für ein wiederkehrendes Produkt gleichbleinbender Qualität stehen würden, wäre dieses „Branding“ für die Kunden interessant. Manche versammeln gar ganze Produktpaletten unter einem „Brand“-Namen um Qualitäten wie Streckmittel- und Verunreinigungsfreiheit, Sortenreinheit und Herkunft zu garantieren. Beispiele aus Amsterdam sind die „Rifman“-Serie und die „Block“-Serie. Was fehlt, ist unter Prohibtionsbedingungen ein echter Verbraucherschutz, der solche Postulate auch zuverlässig und unabhängig mittels Analysen und Herkunftsüberwachung laufend kontrolliert.
So bleibt immer noch festzuhalten: Die Vielfalt der Namen ist gross, die der Waren nicht ganz so. Nicht alles, was blumig angepriesen wird, lässt sich auch gut rauchen und verschafft den imaginierten Törn.
Exkurs: Der Begriff Haschisch
Mit Haschisch bezeichnete man im 19. Jahrhundert und noch weit ins 20. Jahrhundert hinein praktisch alle psychoaktiven Hanfprodukte zum Rauchen oder Essen, also nicht nur wie heute, durch Siebungsmethoden oder Abrieb konzentrierte Hanfharzprodukte der weiblichen Blüten- bzw. Fruchtstände. „Haschisch“ ist arabisch für Gras im Sinne von Heu. Der Begriff „Haschisch“ (Gras) für psychoaktiven Hanf ist schon viele hundert Jahre alt.
TÜRKEI
„Grüner Türke“, „Türke“, „Gypsy“
sind Bezeichnungen für Haschisch aus der Türkei. Türkisches Haschisch kam in den Siebzigern bis Anfang der Achtziger Jahre noch öfters auf den deutschen Markt. Heroin ist aber schon lange ein wesentlich einfacher zu schmuggelndes und profitableres Exportgut. Damit ist „Türke“ fast Legende. Er kam früher in grünlichbraunen, sehr dünnen, sehr hart (und heiss) gepressten flachen „knackigen“ Platten mit einem gewissen Gehalt an pulvrigen blättrigen Bestandteilen. Seine Qualität reichte von „gutes mildes Gebrauchsdope“ bis hin zu würzigen excellenten „ziehenden“ psychedelischen Qualitäten, vergleichbar mit potentem Marokk. Sehr guter „Türke“ hatte eine gewisse Eigendynamik. Ein Kenner nannte es mal „New Wave-Dope“.
„Antonia Hasch“ galt in den Siebzigern (in der Türkei) als das Beste.
„Türke“ wurde nicht selten als Pulver nach Deutschland importiert, um dieses, hier zusätzlich mit Streckmitteln (z.B. Henna) versetzt und gepresst, gewinnbringend zu verkaufen. Die Folge: „Türke“ konnte seinem legendären Ruf meist nicht gerecht werden.
Wenn er in den vergangenen Jahren überhaupt einmal erhältlich war („Super Turkey“), dann meist in mäßiger bis mittlerer Qualität.
Relativ neu ist in der Türkei der klandestine Anbau potenten Grases aus importierten Hybrid-Sorten, womit sich die Chance für ein Revival von potentem „Türken“ ergibt, dann allerdings in neuem Gewand.
„Kurde“
Seit einigen Jahren blüht in der südost-türkischen Provinz Diyarbakir der Cannabisanbau. Der
Lice Distrikt gilt als ein Anbau-Zentrum. Neben getrockneten Blütenständen soll daneben zu
hellbraunen Platten gepresstes Haschisch produziert werden. In den Kurdengebieten auf der irakischen Seite soll in jüngster Zeit der Hanfanbau zur Haschisch-Gewinnung eingeführt worden sein. Die Region ist in Folge der Politik gegenüber der lokalen (kurdischen) Bevölkerung und der Nähe zu den Bürgerkriegsschauplätzen in Syrien und dem Irak (2017) instabil.
LIBANON
„Libanese“
Libanon war viele Jahrzehnte lang einer der Grossproduzenten von Haschisch. Der erste Boom begann in den 1920er Jahren als der Anbau in Griechenland zum Erliegen kam. Nirgendwo sonst wurde die Haschischherstellung in so professionellem Massstab betrieben: Anbau in riesigen Feldern, Abtransport der Ernte mit Traktoren und LKWs, seit den Achtziger Jahren Sieben mit vollautomatischen Rüttelsieben, Pressen mit grossen Hydraulikpressen, Ölextraktion mit Enklaven, Schmuggel und Profitverteilung straff über Klans organisiert. Dementsprechend gibt es keine allzugrosse Produktvielfalt, wenn auch an Stempeln für die Leinensäckchen kein Mangel herrscht(e). („Welchen Stempel hättens gern?“) Wirklich gute Qualitäten aus dem Libanon wurden in den Achtziger Jahren ab der Ernte 1983, wohl auf Grund der lieblosen industriellen Grossproduktion nach dem Motto „Masse statt Klasse“ auch zur Finanzierung der Bürgerkriegsfraktionen, selten. Stattdessen beherrschte, besonders Ende der Achtziger, kratziger mit üblen Bindemitteln gestreckter (von Motoröl, Paraffin und Wachs war die Rede) „Libanese“ den Markt („Platte“). Seine Wirkung war schwach, kraftlos, stumpf, „zufrieden machend“, ermüdend und vergänglich; das passende drömelige Hasch zum Joint (oder zur Purpfeife) zum Bier zum Punkkonzert. Teilweise handelte es sich vielleicht auch um ein ausserhalb des Libanons zusammengemengtes Produkt. Dieses Hasch war von Anfang der 1990er Jahre an in Folge einschneidender polizeilicher und militärischer Massnahmen im Hauptanbaugebiet (Bekaatal bei Baalbek) praktisch verschwunden.
Es wurde auch aus der Hoch-Zeit des Anbaus berichtet, dass im Libanon selbst nur vier Qualitäten unterschieden würden. In den Siebzigern hiess es, der erste Siebungsgrad sei doppelt so stark wie der erheblich grobere vierte Grad; Haschöl sei sogar etwa zehn mal so potent.
Analysen ergaben, dass der Gehalt an dem Wirkstoff THC in libanesischem Haschisch früher allgemein oft erstaunlich hoch war. Er ist bei heutigen Analysen jedoch eher niedrig. Charakteristisch war jedoch früher wie heute ein mindestens doppelt so hoher Gehalt an dem die THC-Wirkung blockierenden und verändernden Cannabidiol (CBD). Dies erklärt vielleicht die typische eher körperlich empfundene Wirkung auch bei hohem Harzgehalt im Vergleich zu der oft eher knisternden Wirkung von marokkanischem Haschisch, bei dem der THC-Gehalt typischerweise doppelt so hoch ist wie der des CBDs (bei einem insgesamt sehr breiten Spektrum an THC-Gehalt von ganz gering bei gestrecktem Haschisch bis sehr hoch bei reinen Spitzenqualitäten). Bei tropischen Rauschhanfblüten findet sich dagegen nur ganz wenig CBD, bei mehr oder weniger hohem THC-Gehalt. Das könnte erklären, warum manche Leute, stimulierenden bis psychedelischen tropischen Grassorten (zu bestimmten Gelegenheiten) den Vorzug geben und Andere sedierendere oder weniger trippige Haschischsorten bevorzugen.
Das spezielle THC-/CBD-Spektrum des klassischen „Libanesen“ könnte für medizinische Cannabis-Nutzer von Interesse sein.
Zur „roten“ Färbung ist noch anzumerken, dass das aus dem Pulver gepresste Haschisch bei grösserem Druck und Hitze gepresst, oder gar von Hand verarbeitet, generell eine dunklere Farbe annimmt. (Dies kann allerdings auch von Farb- und Bindemitteln herrühren.)
„Roter Libanese“, „Roter“ oder „Red Leb“
verdient dennoch einen eigenen Absatz, denn in seiner ursprünglichen Form hat(te) er das Zeug zum „Apothekenhasch“. Als spezielle Sorte setzte er in gewisser Weise Massstäbe. Typischerweise kam er in dicken rechteckigen, an den Seiten abgerundeten Platten (200g oder 500g), in mit Stempelaufdruck versehenen Leinensäckchen. Seine Farbe war aussen deutlich rötlichbraun, im Inneren eher heller olivbraun. Die rote Farbe wird auf die Ernte vollreifer auf dem Feld verdorrter „gerö(s)teter“ Pflanzen, auf heisse und starke Pressung oder Verarbeitung mit der Hand zurückgeführt. Das Haschisch roch charakteristisch würzig medizinisch (wohl auch nach den mit Kalk bestäubten Leinensäcken). Der Ölgehalt war relativ hoch, die Konsistenz cremig. Der Törn war ausgeprägt euphorisch, erhebend, ohne die Gedanken zu verwirren, angenehm körperlich, bisweilen aphrodisisch, enthemmend und humorig, aber kontrollierbar nach Bedarf. Die Potenz war gut, allerdings nicht sensationell. „Roter“ dieser legendären Qualität ist in Folge des Libanonkrieges von 1982 schon seit 1983 praktisch verschwunden. Danach wurde bis Anfang der 1990er Jahre Massenware niedriger Qualität produziert. Saisonal, so von 2005 bis 2007 und ab 2013 wurde trotz schwieriger Verhältnisse und Auseinandersetzungen vor Ort (z.B. Yammoune) immer wieder oder weiter produziert. In holländischen Coffeeshops wieder verbreitet, sind die typischerweise meist mäßigen bis mittleren Qualitäten auf Grund der Konkurrenz potenten Grases und guten Marokks auf dem deutschen Markt eine Rarität geblieben.
„Red Bird“
steht für gute Qualität „Roter Libanese“, sehr ölig, ursprünglich angeblich mit Steinen gepresst.
„Red Gold“
hiess eine klebrige, bei Wärme von Hand knetbare, würzige, in „fetten“ Stücken Anfang der Achtziger Jahre verkaufte Sorte, die von aussen dunkel rotschwarz, von Innen tief rotbraun war und alle Eigenschaften eines leckeren „Libanesen“ (bei günstigem Preis) aufwies. Die Bezeichnung wurde auch allgemein für guten „Roten“ gebraucht.
Unter Wärme knetbarer „Roter“ der neuen Generation (2018) biete „nicht nur ein interessantes charakteristisches Oldschool-Geschmackserlebnis an klassisches harziges Wasserpfeifenhaschisch erinnernd“, sondern auch „einen typischen körperlich wie eine freundschaftliche Umarmung angenehmen psychisch anregenden aber auch ruhig einhüllenden Törn wie eine heilende Beschäftigungstherapie“. Soviel der blumigen Worte eines Cannasseurs. Für dieses qualitativ hochwertige eher kürzer wirkende Produkt mittlerer Potenz besteht auf Grund der spezifischen Charakteristika Potential.
„Gelber Libanese“, „Gelber“, „Yellow Leb“, „Blonde Leb“ oder „Blonde“
hat den Ruf gehabt, schwächer als „Roter“ zu sein. Wahr ist, dass er nie sonderlich stark war. Dafür war er seltener gestreckt und hat den schlechten „Roten“ Ende der Achtziger meist locker übertrumpft, was allerdings keine schwere Übung war. Seine Farbe ist sandig-gelbbraun, seine Konsistenz bröckelig, aber harzig. Dies soll auf früher geerntete Pflanzen (es wird auch behauptet dieses Haschisch käme aus einem anderen im Spätsommer regnerischen Gebiet im Libanon nordöstlich von Beirut, wo meist früher geerntet würde), eine schwächere kalte Pressung oder eine grobere Siebung zurückzuführen sein. Der Törn ähnelt dem von gutem „Roten“, ist aber deutlich milder. Geruch und Geschmack sind nicht so charakteristisch, heller und kratziger. Er taucht in den letzten Jahren in Deutschland wieder auf, aber ebenso selten wie „Roter“.
„Yellow Bird“
soll der Name für einen mit dem „Red Bird“ vom Ausgangspulver her identischen, aber kaltgepressten „Gelben“ sein.
SYRIEN
-der direkte Nachbar vom Libanon und der libanesischen Anbaugebiete, hat in der Vergangenheit vereinzelt Haschisch vom Typ „Gelber“ geliefert, zum Beispiel hellgelbes, bröseliges, aber knetbares, grobes, aber harziges, scharf kratziges, gut aufgehendes, beim Abkühlen verklumpendes, in grosse Kugeln(!) gepresstes Haschisch, in Geruch und Wirkung ähnlich passablem „Gelben Libanesen“. Es ist denkbar, dass im Rahmen des Bürgerkrieges auch zu dessen Finanzierung, wieder vermehrt Hanf zur Haschischgewinnung angebaut wird. So wurde es zum Beispiel von kurdischen Regionen behauptet.
ÄGYPTEN
Auch in anderen nordafrikanischen (in Tunesien und Algerien für lokalen Bedarf) und nahöstlichen Ländern (in „Kurdistan“ und dem Iran besonders in den Siebzigern) wurde und wird vermutlich in eher bescheidenem Umfang gutes Haschisch hergestellt. Ein Urlauber aus Ägypten berichtete vom Sinai, dass dort von den Beduinen nicht nur Gras (Rauschhanf) angebaut wurde, sondern ein äusserlich dem „Roten“ ähnliches, aber anders schmeckendes, belebendes inspiratives Haschisch hergestellt würde. Er sprach von „Blubbidope“, „Erfinderdope“.
AFGHANISTAN
„Schwarzer Afghane“, „Afghan“ oder „Schwarzer“ (unbestimmter Herkunft)
wirklich guter Qualität verschwand mit Beginn des Guerillakrieges gegen die sowjetischen Besatzer Anfang der Achtziger vom Markt. Man verlagerte die landwirtschaftlichen Aktivitäten auf den profitableren Anbau von Schlafmohn zur Opiumgewinnung. Dennoch hat es „Schwarzen“ auch weiterhin immer gegeben, zum Grossteil allerdings aus Pakistan stammend, teilweise vielleicht auch aus Öl und/oder Pulvern marokkanischer und libanesischer Herkunft zubereitet.
Die afghanischen Indica-Hanfpflanzen wachsen im Land auch wild und werden überall in den Tälern der bergigen Regionen in kleinen Pflanzungen, Mischkulturen und auf teilweise riesigen Feldern angebaut. Haschisch aus den nördlichen Berg-Provinzen gilt als besonders gut (z.B. „Mazar-I-Sharif“).
Typischerweise ist „Afghane“ aussen mehr oder weniger glänzend-schwarz und innen grünlich-, tiefbräunlich-(bei den besten Qualitäten) oder grauschwarz gefärbt. Er läuft schnell dunkler an. „Afghane“ ist weich bis sehr weich und lässt sich sehr gut kneten. Er kommt in allen mäglichen Formen in den Handel, als Platten, Sticks, Würste oder Kugeln. Beim Erhitzen wird er backsig. Typisch ist ein scharfer würzig-animalischer Geruch bei mit tierischem Fett (Ziege, Schaf) zur Konsistenzverbesserung versetzten Stücken. Ohne Zusatz riecht er kräftig süsslich-würzig schwer, eventuell mit einer rauchigen Note von der traditionellen Pressung am Holzfeuer. Afghane brennt schwer und langsam mit süssem qualmigen Rauch, sehr anheimelnd, klischeehaft. Der bisweilen kratzige Qualm ist besonders bei dem häufigen „Ersatz-Schwarzen“ nicht leicht zu inhalieren. Der Rausch ist geprägt von einem tiefen wohlig-eingelullten Stonedsein, das ich nicht psychedelisch nennen würde; kann aber sehr introspektiv sein. Leider macht der gängige „Afghane“ meist recht müde, Typ „Schlappmacher“; kein Dope für die Anforderungen des Alltags, eher als Schlafmittel geeignet. Exzellente Qualitäten ermüden nicht so. Die Potenz kann hervorragend sein, soll heissen, ein, zwei Züge langen schon. Derartige Leckerlis sind aber selten.
In Folge der Besetzung Afghanistans durch westliche Truppen, erlebte nicht nur der Opiumanbau einen erneuten Boom, sondern auch die Haschischgewinnung ein Revival. Seitdem gibt es auch wieder qualitativ hochwertigeres Haschisch gewonnen durch den Anbau charakteristischer lokaler „Indica“-Sorten. Bei der heutigen Produktion unterscheidet man nach Qualität drei Siebungsgrade des durch Ausklopfen der weiblichen Fruchtstände über mit einem Siebungstuch bespannten Schüsseln gewonnenen Haschischpulvers (First, Second und Third Garda). Diese Pulver werden nach Belieben gemischt. Der Wert richtet sich nach dem Harzgehalt. Manchmal bezeichnet man auch die lokale Herkunft des Haschisch in dessen Namen. Dieses Haschisch weist in der Regel einen zu den marokkanischen und europäischen Qualitäten vergleichsweise niedrigen THC- und einen deutlich höheren CBD-Gehalt auf. Auch der Gehalt an durch Alterung und schlechte Lagerung entstandenem CBN (Cannabinol) kann hoch sein und trägt zu seinen meist wenig trippigen oder stimulierenden, sondern eher einhüllenden und (evtl. medizinisch nutzbaren) ermüdenden Qualitäten bei. Nicht allzu viele an klassischen relativ frisch importierten unverschmutzten Top-Qualitäten mit hohem THC-Gehalt orientierte Ausnahmen bestätigen die Regel. Diese Qualiäten sind nach wie vor so selten, wie sie auf Grund ihres außergewöhnlichen Geschmacks und ihres spezifischen Cannabinoidspektrums mit körperlichem glockig-narkotischem Törn bei Oldschool-Cannasseuren gefragt sind.
Auch hier gibt es insbesondere in niederländischen Coffeeshops mitunter eine Explosion an Namensbezeichnungen, deren reale Grundlagen schwer zu eruieren sind. „Sarasa-Pollen“ ist so ein Name, der mittels einer russischen Bezeichnung zaristische Qualität suggerieren soll.
„Sheerik“
soll der Name für in kleinen Platten handgepresstes afghanisches Haschisch bester Qualität gewesen sein, wie es in den 1970er Jahren noch Teilnehmern an Buzkashi-Veranstaltungen als Prämie überreicht worden sei.
„Schimmelafghane“
wurde ein von weissem Schimmel durchzogener „Schwarzer“ genannt, um ihn Ahnungslosen als Besonderheit anzudrehen. Wahr ist, dass Schimmelbildung auf nachlässige schlechte Knetung unter Zufügung von zuviel Wasser und falsche Lagerung hinweist. Auch, wenn das Haschisch trotzdem nicht allzuviel von seiner Potenz verloren haben mag, ist aus gesundheitlichen Gründen generell vom Konsum verschimmelten Haschischs abzuraten. Kauft keine verschimmelten oder auf andere Weise verunreinigten Cannabisprodukte! Auf Schimmel und Fäulnisprozesse entweder schon an den verarbeiteten Pflanzen oder erst im Haschisch selbst, weißt auch schon ein typischer stechend-ammoniakalischer Geruch der Ware hin.
„Border Afghan“
wurde der seit dem Bürgerkrieg erhältliche meist über die Grenze nach Pakistan geschmuggelte „Afghane“ genannt. Manchmal meint man damit auch Haschisch aus der pakistanisch-afghanischen Grenzregion. Wie dem auch sei, seine Qualität erinnerte nur sehr selten an die des „klassischen Afghanen“.
PAKISTAN
Der im Osten an Afghanistan grenzende Nachbar war trotz des Schlafmohnanbaubooms zu Beginn der Achtziger Jahre nach wie vor (und seit Ende der Achtziger auch bei uns auf dem Markt bemerkbar) einer der grössten Haschischproduzenten und -exporteure der Welt. Hanf wird zwar hauptsächlich angebaut (besonders im Nordwesten), wächst aber auch in weiten Teilen des Landes wild. Es handelt sich um Pflanzen vom Typ „Indica“ sowie Mischformen mehr in Richtung der im indischen Himalaya gedeihenden hochwüchsigen „Sativas“ (deren High aber noch dem „Indica-High“ nahesteht). Das Haschisch wird ähnlich wie „Afghane“ hergestellt, aber in großem Massstab und unter Zuhilfenahme von grossen Pressen. Leider ist Pakistani ebenso wie Afghane oft schon über ein Jahr alt, wenn er bei uns den Markt erreicht. Das typische Verhältnis von THC zu CBD (siehe oben) wird übrigens mit 1 zu 1 angegeben, bei wechselnden, aber meist eher höheren Wirkstoffgehalten. Trotz recht schwankender Potenz werden bei uns im Handel kaum Sorten unterschieden. Man darf schon froh sein, wenn man mehr erfährt, als dass es sich um „Schwarzen“ handelt, nämlich um
„Schwarzer“ oder „Dunkelbrauner Pakistani“, „Pakistani“ oder „Paki“
„Paki“ ähnelt „Afghanem“, ist allerdings meist härter, aber noch knetbar, und kommt typischerweise in grosse mitteldicke Platten (500 g oder 1kg) gepresst, gut schneidbar. Aussen ist er schwarz oder schwarzgrau glänzend, innen meist dunkelbraun, manchmal grünlichschwarz. Der Geruch ist würzig ähnlich „Afghanem“. Der Qualm kommt auch ähnlich, manchmal allerdings harscher, irgendwie an nicht so guten, etwas kratzigen „Libanesen“ erinnernd. Seine Potenz liegt eher im (oberen) Mittelfeld, selten überraschend gut. Das High erinnert auch an „Afghanen“, ruhig, tief, euphorisch, in der Regel nicht ganz so ermüdend, aber irgendwie charakterlos. In Ausnahmefällen handelt es sich um beglückende, wirklich feine, starke Qualitäten. Diese kommen vereinzelt aus dem Pathanengebiet (Khaiberpass) in der Grenzregion zu Afghanistan oder besser noch aus den Hochgebirgstälern (des Hindu Kush), von denen „Chitral“ („Chitral Hash“) und „Swat“ die bekanntesten sein dürften.
„Morgentau“
Eine herausragende pakistanische Sorte von Anfang der Achtziger Jahre wurde hier unter dem Namen „Morgentau“ vertrieben. „Und ich sah die Sonne aufgehen!“
„Garda“
ist (wie auch in Afghanistan) die Bezeichnung für durch Siebung durch ein Tuch gewonnenes Haschisch-Pulver. Im Paschtunen-Gebiet (den Tribal Areas der Nordwest-Provinz) wird die beste Siebung „Awal Namber Garda“ genannt. Lokal geschätzt wird Haschisch, dass durch Einnähen von 6-10 kg Garda in Ziegen- oder Schaffelle und mindestens 3-monatige Lagerung bei nicht zu großer Wärme gewonnen wird. Als Lieferant von hochwertigem Haschisch („Black Gold“) gilt die Bergregion Tirah Maidan bzw. das Tal von Tirah. Der Ort Jamrud ist eine Haschisch-Handelszentrale. In Folge von Stammeskonflikten kam es 2013 zu Ernteausfällen. Die ganze Region gilt als gefährliches Krisengebiet (2016).
Exkurs: Analysedaten
Eine kleine Anmerkung zu Analysedaten sei gestattet. Sie können sicher sehr hilfreich sein und sind besonders für die Gesundheitsvorsorge interessant (deshalb her damit). Aber werden wir den Geist eines exquisiten Weines an seinem Alkoholgehalt und an der Öchslezahl erkennen?! Ganz ähnlich verhält es sich mit Cannabis. Die Seele des Hanfes erschliesst sich nicht im Labor, sondern im Genuss.
INDIEN
das Land des psychoaktiven Hanfes schlechthin. Cannabis ist eine, wenn nicht die heilige Pflanze Shivas und anderer Gottheiten. Hier sind orale Zubereitungen aus den Blättern (Bhang) quasi legal, aber außer in religiösen Kontexten nicht die weiblichen Blütenstände (Ganja) oder das von den Blütenständen gewonnene Haschischharz (Charas), was der Präsenz und Erhältlichkeit aber keinen Abbruch tut.
Haschisch wird zwar mittlerweile auch durch Siebung getrockneter Pflanzeen gewonnen, im Indischen Himalaya aber traditionell nach wie vor zwischen den Händen an frischen Pflanzen oder von frisch abgezupften Blütenständen gerieben. Pro Tag könnten gerade einmal 4-5 Gramm Spitzenqualität, maximal 1 Tola (ca. 10 Gramm) guter Qualität gerieben werden. Wenn die einzelnen Reibungen gleichmässig miteinander vermengt und sorgfältig durchgeknetet werden, ergibt sich ein einheitliches Produkt. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Ertrag jeder einzelnen Reibung sichtbar getrennt von den anderen gehandelt wird. Wer nicht direkt beim Hersteller etwas grössere Mengen kauft, erhält in Indien aber leider bisweilen Haschisch, das aus verschiedenen Reibungen und Herstellungen (auch grobe Siebungen) zusammengewürfelt oder so zu einem Brocken zusammengepresst ist, dass die Trennung der zum Teil völlig unterschiedlichen Qualitäten schwer, wenn nicht unmöglich ist. Die Qualität handgeriebenen Haschischs ist von vielen Faktoren abhängig. Hinzu kommt die in Indien verbreitete Praxis des Streckens. Die Folge: Grosse Qualitätsschwankungen innerhalb der überwiegend von Kleinschmugglern importierten Mengen (im Bereich von mehreren hundert Gramm bis einige Kilogramm). So kann man kaum von Sorten sprechen und auch Herkunftsangaben bieten keine Gewähr für die mit ihnen assoziierte Qualität. Sie geben allerdings einen Hinweis darauf, wo mit excellenten Qualitäten gerechnet werden kann.
Durch den seit den 1990er Jahren boomenden Massentourismus in die Anbau- und Haschischgewinnungsgebiete des Himachal Pradesh überstieg die Nachfrage vor Ort, das, was gewonnen werden kann, so dass in Touristen-Hotspots wie Kasol sogar minderwertiges Haschisch aus Afghanistan und vor Allem Nepal und Mischungen daraus als lokale Spezialität verkauft wird. Auch bei den regionalen Spezialitäten kann man sich ohne etablierte Verbindungen nicht auf mit Qualität assoziierte Herkunftsangaben verlassen. Nepalesische Wanderarbeiter im Parvati-Valley reiben bis zu 50 Gramm minderer Qualität am Tag.
Die überstürzte Anlage von neuen großen Hanfplantagen zur Haschischgewinnung aus minderwertigem Saatgut soll nicht nur zur Produktion von schlechtem THC-armen Haschisch, sondern durch Pollenflug in manchen Gegenden zu einer deutlichen Verschlechterung der lokalen genetischen Basis geführt haben. Auf der anderen Seite haben Freaks hier wie anderen Orts hochwertiges internationales Saatgut eingebracht, das in den Höhenlagen des Parvati-Valleys (bis über 3000 m) mittlerweile verbreitet angebaut wird, aber auch die speziellen lokalen Genetiken nachhaltig verändern kann. Neu sind auch andere Methoden der Haschischgewinnung, zum Beispiel mit Hilfe der Ice-o-later-Bags. Auch die neuen Öl-Extraktions-Methoden werden hier wahrscheinlich eingesetzt werden.
Die Gesamt-Haschisch-Produktion in Himachal Pradesh wird auf einen höheren zweistelligen Tonnenbereich geschätzt.
Analysen ergaben ein weites Spektrum von THC- ebenso wie CBD-Gehalten in diversen Haschisch-Proben. Dies bestätigt die Vielfalt der bereits lokal heiß begehrten und verehrten Produkte aus der heiligen Pflanze Shivas.
„Charas“, „Charras“
ist der indische Name für Haschisch. Bei uns wird damit meist Haschisch vom Typ „Schwarzer“ aus Indien („Inder“) bezeichnet, dessen genaue Herkunft unbekannt ist. Die Qualitäten sind wie gesagt stark schwankend. Aber meist schmeckt und riecht es dafür bei der Verbrennung irgendwie nostalgisch süsslich nach indischen Räucherstäbchen. Dies tröstet auch bei den reichlich vorhandenen mittleren bis schlechten „Charas“-Stücken, deren Harzanteil nur gering ist. Es können sich reichlich Pflanzenteile oder gar Samenbruchstücke finden. Streck-, Binde- und Würzmittel sind verbreitet. Auch ist das Produkt nicht selten überaltert. Manchmal ist es recht verwunderlich, was da aus der Heimat einiger der besten Haschischqualitäten der Welt unter hohem persönlichen Risiko geschmuggelt und unter grossem Brimborium unter die Leute gebracht wird. „Charas“ kommt typischerweise in Stangenform (hart bis steinhart) oder in dünnen zähen Streifen, aussen schwarzglänzend und innen braun- oder grünschwarz. Weicher „Charas“ präsentiert sich daneben auch in allen möglichen anderen klumpigen Formen. Weiches Haschisch („Finger“, „Balls“, „Cream“) ist meist besser als die harte Stangenform („Sticks“). Diese kann aber auch recht gut sein. Für gutes indisches Haschisch ist eine ausgesprochen euphorische, ruhige Note charakteristisch, mit einer den Geist beflügelnden Komponente bei den besseren Qualitäten. Indisches Haschisch ermüdet nicht allzusehr und kann über einen längeren Zeitraum geraucht werden.
Schlechte Qualitäten sind ziemlich kratzig und lungenbelastend. Es gibt Sorten, die in Potenz und High kaum über Tabak hinauskommen (von wirkungslosen Imitaten ganz zu schweigen), minzig riechendes hartes trockenes und überlagertes, hauptsächlich auf den Körper hauendes Zeug, ein fauler Kompromiss für jede anständige Kifferin.
Spitzenqualitäten stammen aus dem indischen Himalaya. Hier gilt die Regel, je höher und abgelegener die Gegend der Haschischgewinnung, desto besser die zu erwartende Qualität. Im Himalaya wird Haschisch sowohl von den überall wildwachsenden teilweise bis zu mehrere Meter hoch werdenden, als auch von auf eigenen Feldern oder zwischen Obstbäumen gezogenen Hanfpflanzen gerieben.
„Kaschmiri“ oder „Dunkelbrauner Kaschmir“,
steht für handgeriebenes Haschisch aus der seit Langem in einer Art Bürgerkrieg mit der Zentralregierung befindlichen, moslemischen Himalaya-Provinz „Kaschmir“ an der Grenze zu Pakistan. Noch heute zehrt Kaschmir von einem lange zurückliegenden Ruf, wahrscheinlich, weil es noch vor Manali einer der ersten Lieferanten für besonders gutes indisches Haschisch war. Leider war „Kaschmiri“, wenn er unsere Breiten erreichte, meist kaum so gut, dass die für ihn geforderten Preise gerechtfertigt waren. Er war oft „weich“, klebrig, aber unelastisch durch Zufügung von Butterschmalz, fettig glänzend, braunschwarz gefärbt, und enthielt nicht selten grobere Pflanzenteile (z.B. Samenschalen). Er war nicht unbedingt schlecht (rundes tiefes High), aber er erfüllte selten, die in ihn gesetzten Erwartungen. Da die Handelsmentalität der Kaschmiris berüchtigt war, wundert es nicht, dass die sicherlich auch vorhandenen liebevoll geriebenen, excellenten Qualitäten bei uns nur in seltenen Ausnahmefällen auf den Tisch gekommen sein sollen. Es soll auch gesiebtes Haschisch aus Kaschmir geben. Auch heute soll noch insbesondere für den lokalen und den indischen Markt Haschisch hergestellt werden.
„Jammu“
die benachbarte Provinz liefert potentiell ebenfalls hochwertiges handgeriebenes schwarzes Haschisch.
Exkurs:
Satellitenaufklärung
Dank Satellitenaufklärung, Luftüberwachung und Drohneneinsatz gerät der Outdoor-Hanfanbau inklusive dem Guerilla-Anbau in der Wildnis mittlerweile weltweit ins Visier der Überwachungsbehörden. In manchen klimatisch für den Freilandanbau von Rauschhanf eigentlich gut geeigneten Regionen findet man deshalb, wo Strom oder Generatoren vorhanden sind, den Wechsel zum besser kontrollierbaren vor Entdeckung zunächst sichereren ökologisch-klimatisch bedenklichen Indoor-Anbau. Ob dieses in vielen (auch Tropen-)Ländern beobachtete Phänomen in Indien für Grower bereits eine Option ist, sei dahin gestellt.
2012 wurden allein in der indischen Himalaya-Provinz Himachal Pradesh an Hand von Satellitenbildern 52 Regionen und etwa 2500 Dörfer ausgemacht, in denen unabhängig voneinander Hanfanbau bzw. die Gewinnung von Haschisch eine wichtige Lebensgrundlage darstellen. Die indische Haschischproduktion liege demnach im dreistelligen Tonnenbereich. Außerdem werden Blätter und Blütenstände (traditionell) zu Bhang und Ganja getrocknet.
„Manali“
ist der Name eines im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh auf etwa 2000 Meter Höhe gelegenen Ortes, in dessen Umgebung seit den Siebziger Jahren unter Einfluss zugeströmter Drogentouristen vom Typ „Hippie“ und „Traveller“ von wilden und angebauten Beständen reichlich Haschisch gerieben wird. Das schwarzbraune bis schwarze, charakteristisch süsslich stechend riechende, hochelastische und gut knetbare Haschisch galt lange Zeit als das Beste, was Indien zu bieten hatte. Seit Längerem ist allerdings auf Grund der hohen Nachfrage die Herstellung meist nicht mehr ganz so sorgfältig. Es wird eiliger und grober gerieben. Auch hat der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln in den Obstplantagen zu einer Belastung dazwischen oder in der Nähe gedeihender Hanfpflanzen geführt. So wird „Manali“ von echten Kennern schon länger nicht mehr so sehr geschätzt. Hinzu kommt, dass der Name nicht gerade urheberrechtlich geschützt ist. Alle möglichen Haschischqualitäten bis hin zu Imitaten wurden Indientouristen schon als „Manali“ angedreht. Grünlichschwarze, pflanzenmaterialhaltige, trockene, harte, alte Stangen vom Typ „Charas“ (siehe oben) verdienen den Namen „Manali“ nicht, selbst dann nicht, wenn sie in dieser Gegend entstanden sein sollten. Rauschhanf wächst im ganzen weitläufigen Tal und auch noch in höheren Lagen in Richtung Rohtang-Paß bis ca. 3000 Meter Höhe. Mancheiner hegt dort einfach liebevoll zum Eigenbedarf ein (paar) „Weihnachts“-Bäumchen von bis zu 4 Metern Höhe neben seinem Häuschen.
„Kulu“ oder „Kullu“
heisst ein im selben Tal (Beas-River) noch vor Manali gelegener, aber nur etwa 1000 Meter hoch angesiedelter Ort mit subtropischem Klima und das dort hauptsächlich von wilden Pflanzen geriebene Haschisch. Es ist zwar auch ziemlich guter Qualität, wird aber aufgrund des heisseren Klimas und der niedrigeren Lage als nicht ganz so begehrenswert eingestuft. Wild wachsende Hanfpflanzen werden hier von 30 cm bis über 6 Meter hoch.
„Jungle“, „Jungly“ und „Begji“
Handgeriebenes schwarzes Haschisch von wildwachsenden Pflanzen aus niederen dschungeligeren Lagen des Himalaya-Gebirges von guter Qualiät wird auch als „Jungle“ oder „Jungly“ bezeichnet. Man benutzt diese Bezeichnung auch um Haschisch von wildwachsenden Pflanzen generell von Haschisch, das von angebauten Pflanzen gerieben wurde, zu unterscheiden. Dieses nennt man dann „Begji“ oder „Baguidjah“.
„Parvati“
heisst das Haschisch aus dem um die Ecke gelegenen gleichnamigen Parvati-Valley (Tal). Das sich sehr lang hinziehende und mittlerweile sehr beliebte wilde Tal ist Lieferant eines handgeriebenen Haschischs, das schon Anfang der 1990er Jahre dem „Manali“ den Rang abgelaufen hatte. Auch hier war der Einfluss von westlichen „Freaks“ massgebend.
„Malana“, „Charas Malana“ oder auch „Malana Cream“
setzte dieser Region die Krone auf. Es bezeichnet ein ursprünglich abgeschiedenes und sich bis über 3000 Meter hochziehendes Tal, das hauptsächlich von dem gleichnamigen Haschisch und den an diesem interessierten, zu Fuss vom Parvati-Valley aus angereisten und ausserhalb des zentralen Dorfes Malana zeltenden Freaks lebte. Hier wird Hanf in grosser Höhe angebaut und sehr sorgfältig gerieben. Kenner unterschieden das Haschisch nach Feld, Höhenlage, Jahrgang und reibender Person. Es gab und gibt kommerzielle Qualitäten, die bereits zur Oberklasse dessen gehören, was den mitteleuropäischen Markt zu stolzen Preisen erreicht. Und für regelmässige Gäste erschlossen sich hier unter Umständen sowohl in Indien als auch weltweit unzweifelhaft an die Spitze gehörende, ölige, elastische, hochpotente, reine, süssliche, euphorisierende und inspirierende Qualitäten, allerdings nur in so kleinen Mengen, dass sich erfolgreiche Schmuggler damit, daheim angekommen, gerademal eine Zeit lang selbst belohnen konnten. In den Niederlanden gab und gibt es einen Markt für derartige Spezialitäten, für die dann Preise bis zu 45 Gulden (40 DM) pro Gramm gefordert wurden. Es handelt sich dabei aber nicht um die rare in nur wenigen Gramm ausgetauschte Top-Qualität, die praktisch nicht gehandelt wird, und die tatsächlich noch einmal deutlich reiner und potenter ist. Pro Tag können von frischen weiblichen Blütenständen nur wenige Gramm Spitzenqualität gerieben werden. Die gesammte eigene Jahres-Ernte des ca. 2000-Einwohner-Dorfes Malana soll nur im dreistelligen Kilogrammbereich liegen, in den Hoch-Zeiten aber 1000 Kilogramm überschritten haben. Dazu gehört allerdings nicht nur „Cream“, sondern auch durchschnittliche „Business“-Qualität.
In Malana hat es mittlerweile massive Veränderungen gegeben: Ein Staudamm im Tal mit einem grossen Wasserkraftwerk sowie eine Strasse wurden gebaut. Polizeiliche Grossrazzien von 2003 bis 2006 und auch danach (z.B. 2011) reduzierten die lokale Haschischgewinnung und verdrängten, ökologisch problematisch, den Anbau in höhere und nur über lange Märsche schwer erreichbare Lagen. 2006 wurden entgegen dem bis dahin herrschenden Kontakt-Tabu Häuser der Einheimischen für Touristen als Guesthouses geöffnet. Eine Grossbrand im Januar 2008 vernichtete den antiken Tempel der lokalen Gottheit Jamlu und viele alte Holzhäuser. Man versucht außerdem die Haschischbauern zum wenig lukrativen alternativen Kräuteranbau zu überreden.
„Jari“
das auf dem Weg nach Malana liegt, wird als Herkunftsbezeichnung für lokales Haschisch benutzt.
„Rasol“
heißt ein etwa 3000 Meter hoch gelegenes Dorf in der Region, das den Ruf hat ein dem „Malana“ nahezu ebenbürtiges Haschisch zu liefern. Es ist vom Traveller-Hotspot Kasol aus erreichbar.
„Tosh Balls“
werden kleine Kugeln hochwertigen handgeriebenen Haschischs aus dem Tosh Village im Tosh Valley genannt. Das Tal ist ebenfalls von Kasol aus erreichbar. Lokal würden 2/3 bis 5 Jahre in Tongefäßen in der Erde eingelagerte ausgetrocknete mildere „Old Balls“ von alten Rauchern sogar höher bewertet als die frische Ware.
„Rajasthani“
heisst Haschisch aus der in die Wüste Thar übergehenden Provinz Rajasthan im Nordwesten Indiens. Viele Regionen Indiens haben eine kleinere ländliche Haschischherstellung für den lokalen Bedarf. „Rajasthani“ aus Jaipur war zum Beispiel bröckelig, grob mit vielen Pflanzenteilen, kaum aufgehend, backsig und potenzmässig eher im Mittelfeld.
„Indian Gold“ oder „Black Gold“
Unter dieser Bezeichnung werden mit Blattgoldaufdruck veredelte kompakte Blöcke und Platten weichen, gräulichschwarzen, gut knetbaren Haschischs mit blumig-parfümiertem Geruch von einheitlicher Konsistenz gehandelt. Die Potenz war ziemlich gut, die Wirkung euphorisch einhüllend. Dieses Haschisch soll repräsentativ für gute auch in grösseren Einheiten professionell exportierte Qualitäten sein, wie sie von Haschischgrosshändlern in Indien auf Lager gehalten werden. Blattgoldstempel allein sind allerdings in Indien keine Garantie für Qualität.
„Bombay Black“
Hierbei soll es sich um ein sehr potentes im Bombay der Siebziger Jahre erhältlich gewesenes, in dicke Würste gepresstes schwarzes Haschisch gehandelt haben. Die Gerüchteküche behauptete, es sei mit Opium versetzt gewesen oder habe Morphin enthalten. Dies ist zwar möglich, aber aufgrund des deutlich höheren Preises für Opium und Morphin unwahrscheinlich. Mit Opium in wirksamer Menge versetztes Haschisch ist kaum rauchbar, es sei denn es wird wie Opium geraucht. Es muss praktisch „verkocht“ werden, schlägt beim Erhitzen Blasen und hinterlässt eine Schlacke mit reichlich unverbrannten Resten. Geruch und Geschmack sind charakteristisch süsslich-chemisch für Opium, beziehungsweise dessen Morphingehalt. Jeder Cannabisraucher würde den Unterschied sofort erkennen. Bei allen als „opiumhaltig“ zur Analyse gebrachten Proben in unseren Breiten, stellte sich heraus, dass es sich dabei um Haschisch mit besonders hohem Gehalt an psychoaktivem THC und/oder der dämpfenden Komponente CBD handelte! Nur sehr selten vermengen KonsumentInnen bei uns absichtlich, getrennt erworbenes Opium mit Haschisch um es gemeinsam zu rauchen. Allerdings ist die Mischung von Opium und Cannabis bei oralen Zubereitungen nicht ganz so ungewöhnlich. In Indien hat sie eine lange Tradition. Meist werden bei derartigen Rezepturen noch andere Drogen (z.B. Stechapfel, Brechnuss, Betel) und Gewürze hinzugefügt.
„Kerala“
Ist ein tropischer Bundesstaat an der Südwestspitze Indiens, in dessen Bergen (Idukki-District) seit Jahren das berühmte Kerala-Gras angebaut wird, aus dem für den Export auch potentes Grasöl extrahiert wird. Angeblich soll von diesem Gras vor Ort auch Haschisch gewonnen werden. Das dürfte interessant sein. In anderen südindischen Bergregionen (z.B. Palani-Hills und Kalyaran Hills in Tamil Nadu) wird ebenfalls ähnlicher Rauschhanf mit „Sativa“-Optik angebaut, seitdem die Anbaugebiete in Kerala immer wieder unter polizeilichen Druck geraten sind. Der Anbau wird in abgelegenere Regionen wie z.B. Naturschutzgebiete verlagert, eine weitere fatale Konsequenz der irrationalen Hanf-Prohibition. Gesiebtes Haschisch von indischen Pflanzen des Kerala-Typus in dünner Platte war hellbraun, trocken, milde aber potent und bot einen erhellenden stimulierenden Törn.
NEPAL
Das Königreich des Haschisch lieferte mit dem zunehmenden Kleinschmuggel in den Neunziger Jahren auch wieder vermehrt in unsere Breiten. „Nepalese“ zehrt immer noch zu Recht von dem positiven Image, das er seit Anfang der „völlig ausgeflippten“ Siebziger Jahre hat. Das Haschisch wird in abgelegenen Gebieten immer noch von Hand gerieben, zunehmend aber auch durch Siebung hergestellt. In vielen Tälern wächst der Hanf überaus reichlich wild zu meterhohen Bäumen heran. Hanf wird aber auch angepflanzt. Es gilt allgemein die Regel, je höher und abgelegener das Herkunftsgebiet, desto vorsichtiger wird gerieben und umso sorgfältiger erfolgt die Weiterverarbeitung (gleichmässiges Durchkneten). Die kommunistische Regierung hat in den letzten Jahren, nachdem sie den Guerillakrieg gegen den diktatorisch herrschenden König auch durch Haschischsteuern finanziert hatte, dem heimischen Hanf den Krieg erklärt. Auf Grund der Armut des von Naturkatastrophen und Mißwirtschaft gebeutelten Landes heißt dies, dass der einst relativ offene Hanfanbau und Haschischhandel noch weiter in abgelegene Regionen und den Untergrund gedrängt wird.
„Nepalese“ oder klassisch „Nepal Shit“
kommt in dicken Platten, Würsten, Kugeln oder anderen Formen, in die er sich pressen oder kneten lässt. Es ist nicht alles erstklassiger „Nepalese“, was verführerisch schwarz und ölig glänzt. Aber typisch für Nepalesen ist sein harziger öliger Eindruck, seine aussen schwarzglänzende und innen dunkelbraun bis braunschwarze Farbe, seine sehr gute Knetbarkeit in der Hand bei einer gewissen Festigkeit im Stück. Bei den besten innen gleichmässig dunkelbraunen kompakten Qualitäten erkennt man, unter dem Binokular vergrössert, nahezu ausschliesslich dicht an dicht gepackte Harzdrüsenköpfe. Der Geruch von gutem „Nepalesen“ ist charakteristsich „voll“ süsslich-aromatisch. Feiner „Nepalese“ ist hochpotent (ein bis zwei Züge langen schon), wirkt phantasieanregend, geradezu orientalisch halluzinogen, sich der inneren Welt zuwendend, die Seele mit kosmischem Gelächter erfüllend und dabei wohlig-euphorisch und recht lange anhaltend, „far out“. „Nepalese“ dieser Qualität ist in Mitteleuropa nur sehr selten erhältlich, aber es soll ihn noch geben. Auf der anderen Seite tauchen gelegentlich vom äusseren Erscheinungsbild her noch öligere nahezu schwarze Sorten „Nepalese“ auf, die zwar ziemlich stark sind, aber leider die Tendenz haben, innerhalb vielleicht einer halben Stunde in einen narkotischen Tiefschlaf zu geleiten oder bestenfalls eine Art wohligen Stupor am Rande des Schlafes hervorzurufen.
„Temple Balls“, „Temple Shit“ oder „Nepal Balls“
stand für sehr guten gleichmässig durchgekneteten aussen schwarzen, innen dunkelbraunen „Nepalesen“ excellenter Qualität, wie er oben beschrieben wurde. Typisch ist, dass er zumindest zu einem Zeitpunkt seiner Herstellung, nämlich nach Abschluss des Knetens Kugelform hatte. Er kann aber auch nachträglich umgeformt worden sein. Eigentlich soll die Bezeichnung darauf hinweisen, dass es sich mit um das Edelste handelte, was Nepal an Haschisch zu bieten hatte, mit solcher Inbrunst hergestellt, dass es auch für Tempelrituale geeignet ist. Auch „Royal Nepal“ ist ein Name für eine klassische handgeriebene Spitzenqualität zu einem Spitzenpreis. In Holland wurden für ein Gramm eines solchen von aussen pechschwarzen, öligen, supergeschmeidigen und leckeren „Königsdope“ Preise bis 45 Gulden (40 DM) verlangt. Auf dem Schwarzmarkt sind verlockende Namen allerdings immer auch mit Vorsicht zu geniessen.
„Himalaya“ und „Super Himalaya“
Mittlerweile sind die royalen Zeiten in Nepal vorbei. Bei nepalesischem handgeriebenen Haschisch unterscheidet man grob in „Himalaya“ und besser „Super Himalaya“. Wenn es auch noch würzig riecht, nennt man es z.B. „Black Spice“.
„Tantopani hash“ und „Gosainkund hash“
sind Herkunftsbezeichnungen für Haschisch, das in den Siebziger Jahren einen sehr guten Ruf hatte. „Gurkha hash“, „Mustang hash“ (auch nach dem Ort „Jomsom“) usw. sind weitere Namen. Das gängige Haschisch aus dem Touristenzentrum „Pokhara“ galt als nicht so gut. Hier haben sich die lokal favoritisierten Regionen mittlerweile möglicherweise geändert. Manchmal werden jetzt auch Herkunftsorte wie „Thaweng“ und „Rolpa“ genannt.
„Charras“
Stefan Haag („Hanfkultur Weltweit“) berichtete („Hanf“ Januar 1996) aus Nepal von grob-gesiebtem Haschisch schwankender Qualität unter der Bezeichnung „Charras“, das gegenwärtig das Standard-Hasch des nepalesischen Schwarzmarktes sei. Dafür gebe es selten eine feine hellgrüne Siebung vom Typ „Pollen“.
„Nepal Pollen“
Immer noch relativ dunkles, aber eher grünlich oder rötlich-brauner trockener mehr stoned machender gesiebter „Nepal Polm“ (holländisch) ist mittlerweile auch auf dem europäischen Markt angelangt.
Durch die internationalen Entwicklungen und Kontakte können sich auch in Nepal Hanfanbau und Haschisch-Gewinnung weiter verändern. Vielleicht bleibt das Geheimnis der sorgfältigen Herstellung erstklassigen handgeriebenen „Nepalesen“ in abgelegenen Regionen noch eine Zeit lang bewahrt, immerhin ist es ein schützenswertes Kulturgut – eigentlich ein Fall für die UNESCO, falls sie sich erleuchten lassen würde.
ZENTRALASIEN
Es wird auch in anderen Gegenden dieser Region Haschisch gewonnen, wenn auch in bescheidenerem Umfang, erstens, weil der Hanf in einem grossen Bogen in den Bergtälern vom Himalaya über den Hindu Kush bis zum Pamirgebirge, Tien Shan, Altai und darüber hinaus z.B. in die zentralasiatischen Steppengebiete wild wächst, und zweitens weil Haschischgewinnung und -gebrauch hier eine lange Tradition haben. Vielleicht werden diese Gebiete mit zunehmender Erkundung durch westliche Reisende und HanfliebhaberInnen in Zukunft Produkte liefern, die dann die Palette auf dem mitteleuropäischen Markt erweitern.
BHUTAN
„Bhutani“
So wird von unter dem Einfluss des zunehmenden Tourismus handgeriebenem Haschisch aus dem buddhistisch beherrschten Königreich Bhutan (Himalaya) berichtet. Es werde dort vereinzelt in kleinen Mengen von harzreichen und potenten schmalblättrigen wild wachsenden Pflanzen im Hauptstadt-Distrikt „Thimpu“ oder im nördlichen Zentrum von Bhutan im „Bumthang“ Distrikt gerieben. Von staatlicher Seite aus gehe man dagegen vor.
CHINA
„Tibeter“
Auch aus den von China kontrollierten tibetischen Himalayatälern wird von Haschischgewinnung berichtet. In den Niederlanden war sehr selten tibetisches Haschisch, zum Beispiel unter dem Phantasienamen „Abominable Snowman“, auf dem Markt gelandet. Tibetisches Haschisch wird als hell, gesiebtem Marokkaner bester Qualität ähnlich beschrieben und ist nicht gerade preisgünstig.
„Yunnani“
Im unter Travellern beliebten Yunnan wächst THC-haltiger Hanf wild. Unter deren Einfluss wird Haschisch wohl gelegentlich mit der Hand gerieben und gelangt selten auch auf den europäischen Markt. Ein solches Produkt war dünnplattig, schwarz mit grünlich-brauner Note, trocken, milde und erinnerte vom Törn her an stimulierendes Importgras mäßiger Potenz. THC-armer Hanf wird seit einigen Jahren vermehrt zur Faser- und Samengewinnung angebaut und könnte die Wildpflanzen-Population genetisch verändern, die von den lokalen Behörden mittlerweile bekämpft wird.
„Yarkandi“
Das heute chinesische Ostturkestan hat schon vor hundert Jahren begehrtes gesiebtes Haschisch nach Indien (!) exportiert. Möglicherweise ist diese Region sogar historischer Ausgangsort für diese Technik. Feines, hellgelbes, gesiebtes Haschisch, nach seinem Herkunftsort „Yarkandi“ genannt, fand in einer kurzen Hochphase ab Anfang der 1990er Jahre mit der Ankunft von Travellern aus dem Westen Interesse und gelangte so außer Landes. Trotz folgender ständig steigender Repression schien es diese Spezialität auch weiterhin noch zu geben. Kashgar („Kashi“) wurde als weiterer Herstellungsort genannt.
ZENTRALASIEN (ehemals sowjetisch)
Auf der vormals sowjetischen Seite Zentralasiens, wo der Hanf in Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Sibirien in großen Beständen wild gedeiht, ist die Herstellung von Haschisch („Gashish“) von THC-haltigem Hanf („Anasha“) nicht unbekannt. Schon in den Siebziger Jahren wusste „High Times“ von „Irkutsk Hash“(Sibirien) und „Tashkent Hash“(Kasachstan) guter Qualität zu berichten.
KIRGISISTAN
„Chocolate“
Cannabisraucher („Nashakur“) und kleine Geschäftsleute reisen bis heute teilweise trotz brutaler staatlicher Kontrollen von weit her an, um im August und September von Wildbeständen mit genügend hohem THC-Gehalt (2-4 % wurden in den getrockneten weiblichen Buds gemessen) zum Beispiel im Chu(y)-Tal zwischen Kasachstan und Kirgisistan und rund um den Yssyk-köl oder Issyk-Kul (See) in Kirgisistan Blütenstände zu ernten und/oder Haschisch zwischen den Händen zu reiben, das „Ruchnik“ genannt wird. Seit Mitte der 1990er Jahre reibt auch die einheimische Bevölkerung für einen Nebenerwerb das lukrative „Kara koi“(“Schwarzes Schaf“). Dabei wird wohl recht hektisch und grob gerieben, wenn man bedenkt, dass 15 bis 25 Gramm dieses schwarzen Haschisch-Produktes mit sichtbarem Pflanzenanteil, das auch „Chocolate“ genannt wird, und als kleine Blöcke in Streichholzschachteln („Korobochka“) gehandelt wird, angeblich schon in zwei Stunden gewonnen werden sollen.
„Tyupskyi ruchnik“
ist von der einheimischen Bevölkerung der Tyup Region im Issyk-Kul Oblat zwischen den Händen in Wildhanffeldern („Kumtor“) geriebenes Haschisch, das einen besonders guten Ruf hat.
KAUKASUS
Den Kaukasus mit seinen wilden in manchen Regionen in der Nähe von Flüssen und Bewässerungsgräben und auf aufgelassen Feldern, sowie manchmal auch in Ortschaften gedeihenden ruderalen Hanfbeständen (z.B. in Nord-Armenien, Berg-Karabach und Südwest-Georgien) sollte man als gut geeignetes potentielles Hanfanbau- und Haschgewinnungsgebiet erwähnen.
TROPEN
Tropische Länder haben traditionell hauptsächlich Hanfblüten, also Marihuana geliefert. Die Haschischherstellung war bis in die Siebziger Jahre weitgehend unbekannt. Folgende Gründe erschweren die Haschischgewinnung: 1. sind die tropischen Hanfsorten zwar oft recht potent, aber dennoch nicht sehr harzig. 2. sind die vorhandenen Harzdrüsen meist viel kleiner als die der Haschischhanfsorten, was die Siebung wie auch das Reiben erheblich erschwert. 3. beeinträchtigt das heisse feuchte Klima die Haschischgewinnung, a. weil Harzdrüsen mit dünnflüssigem Harz leicht platzen und die Siebe verkleistern, b. weil sich die Wirkstoffe relativ schnell abbauen und die Qualität stark leidet. 4. Fehlende Nachfrage und Wege zu den Absatzmärkten, eine Vorraussetzung dafür, dass das Geschäft überhaupt in Gange kommt.
Nun reisten Rauschhanfunternehmer in den Siebziger Jahren in die Länder, die vor allem den US-Markt mit Marihuana überschwemmten. Sie brachten nicht nur eine Nachfrage nach besonderem samenlosen Gras (Sinsemilla) sondern auch nach exotischen Spezialitäten, namentlich Haschisch mit. Gleichzeitig brachten sie von Reisen in die traditionellen Haschischländer Know How mit. Bei grosser Konkurrenz und vorübergehend nahezu gesättigtem Markt, begann man also auch in klassischen Marihuanaanbauländern auf Nachfrage hin Haschisch herzustellen.
Mit gekühlten „Pollinatoren“ oder bei Unterbringung der Siebungsgerätschaften in Kühlräumen oder der Anwendung von Ice-o-lator-Siebungs-Säcken lässt sich auch in heißen tropischen Gegenden wie z.B. in Westafrika Haschisch gewinnen. So wurden schon in den 1990er Jahren (in der Schweiz) „Pollinatoren“ gebaut, in die der Hanf mit dem Gabelstapler gefahren wurde. Außerdem herrscht mittlerweile ein weltweiter Austausch an Saatgut, der die Märkte weiterhin in Bewegung halten wird.
MEXIKO
„Emerald Hash“ aus Mexiko
stellte eine seltene grüne gesiebte Spezialität dar, die wohl nur von wenigen Amis gekostet wurde. Die Herstellung dieses Exotikums (hier aus Oaxaca) der Siebziger Jahre zeigt Michael Starks anhand von Fotos in seinem Buch „Marihuana Potenz“.
KOLUMBIEN
„Chicle Hash“ aus Kolumbien
soll laut „High Times“ in der zweiten Hälfte der Siebziger Jahre von den Spitzen ausgewählter Marihuana-Pflanzen aus dem Llanos-Valley gerieben und als ausgesprochene Spezialität in kleinen Mengen in die USA geschmuggelt worden sein, wahrscheinlich „Dealers Stuff Only“, ein schwarzgrünes Haschisch mit sichtbarem Pflanzenanteil.
In Kolumbien wurden in dieser Zeit auch grössere Mengen „Columbian Hash“ hergestellt und in die USA exportiert. Dieses war allerdings so nachlässig hergestellt (eher ein Haschisch-Imitat), dass es einen sehr schlechten Ruf genoss und als „Besonderheit“ zu Beginn der Achtziger Jahre vom Markt verschwand.
Mittlerweile wird in Kolumbien hochprofessionell Sinsemilla aus lokalem und internationalem Saatgut angebaut. Nebenbei werden nach modernen Methoden Haschisch und Ölextraktprodukte hergestellt. Dabei werden auch Gewächshäuser, Indoor-Locations und Kunstlicht verwendet. Das ist ökonomisch und von Qualitätsstandards aus betrachtet wahrscheinlich vernünftig, allerdings für Nostalgiker traurig: Gehen so doch nicht nur die Besonderheiten lokaler Genetiken („Landrassen“), traditioneller Anbaumethoden und des Terroirs flöten, auch die Ökobilanz dürfte meist erheblich schlechter ausfallen.
JAMAICA
„Jamaican Black“
wurde ein Produkt genannt, das in den Achtzigern in Grossbritannien auftauchte. Es wies einen THC-Gehalt nicht höher als durchschnittliches Jamaika-Gras auf, törnte auch so und sah aus wie roh gemachtes Haschisch. Es wurde vermutlich aus zu Brei zermahlenen Pflanzenteilen gepresst. Gutes originales „Sativa“-Jamaika-Gras wirkte damals kräftig, stimulierend mit sinnlicher Körperlichkeit.
„King of the Jungle“
Liebevolle Bezeichnung für Haschisch aus Eigenproduktion, korrekter wäre wohl „Queen of the Jungle“. In Jamaika werden mittlerweile von ambitionierten Growern potenter Graspflanzen meist internationaler Provenienz allerdings auf Kosten von deren Gras-Qualität durchaus bemerkenswerte Mengen unterschiedlich gefärbtes handgeriebenes Haschisch grober bis begehrter ausgezeichneter Qualität hergestellt. Auch durch Siebung gewonnenes Haschisch unterschiedlicher Färbung und Potenz gehört zum Repertoir mancher Grower: „Blond“, „Red“, „Black“. Durch die Nähe zu den USA und internationale Kontakte hat man seit Langem und laufend Zugang zu diversen Genetiken und Techniken und ist mit neuen Nachfragen konfrontiert. Hier ist bei landestypischem tropischem Outdoor-Grow erhebliches Potential für interessante Produktvielfalt, die in kleinen Spezialitäten-Mengen als original „Jamaican Hashish“ auch schon die internationalen Märkte erreicht hat. Eine Probe dieser kommerziellen Export-Ware zeigte sich braun, unter Wärme und Druck knetbar, eine ziemlich reine einheitliche Siebung von Drüsenköpfen, milde rauchbar, geschmacklich erinnernd an das Outdoor-Gras der gleichen Provenienz in Harz konzentriert, ebenso das potente energetische THC-High voller „positive vibrations, sweet-smart rocket-start, a true jamaican project“.
PARAGUAY
„Cera Paraguaya“
Paraguay ist ein großer Gras-Produzent und versorgt seine Nachbarländer. Als Nebenprodukt werden braunschwarze mit den Händen gewonnene Haschisch-Kügelchen von ca. 3 Gramm Gewicht hergestellt, die „Cer(it)a Paraguaya“ (Paraguayanisches Wachs) genannt werden. Wenn sie mit zuviel Feuchtigkeit hergestellt wurden, neigen sie zum verschimmeln.
SENEGAL
Auch hier wurde aus dem einheimischen Marihuana „Jamba“ ein helles gelbliches Haschischpulver gesiebt, vermutlich um exklusiven Kundenwünschen zu entsprechen. Wegen dem hohen THC-Gehalt tropischer Grassorten, dürfte sorgfältig zubereitetes und aufbewahrtes Haschisch eine delikate Variante mit einem potenten stimulierenden bis psychedelischen High sein. Die politisch instabile Casamance ist das traditionelle Hauptanbaugebiet für Marihuana. Im von Senegal umschlossenen Gambia ist besonders die (Halb-)Insel „Gunja-Island“ im Gambia-Fluss berühmt.
PHILIPPINEN
„Headhunter Hash“ oder „Philippine Hash“
wurde seit den Siebziger Jahren nicht nur für Ami-Soldaten, sondern auch für den lukrativen japanischen Markt hergestellt. Tauchte nur sehr selten bei uns auf. Eine Probe roch minzig und rauchig-„kautschukartig“, mitteldicke harte Platte von hellbrauner Farbe, relativ feine Siebung, trocken, pulvrig, Potenz schwach, aber bei genügender Menge, verwirrendes High, „nüchtern und gleichzeitig ziemlich albern und strange neben sich sein“, war wahrscheinlich überlagert, keine Konkurrenz zu dem gängigen teilweise sehr guten THC-reichem traditionellen Gras der gleichen Provenienz.
Mittlerweile werden in dem traditionellen Cannabis-Anbaugebiet in den Reisterrassen-Bergen der Igorot um den Ort Sagada im Norden der Hauptinsel Luzon zunehmend internationale Top-Hybrid-Kreuzungen angebaut. Daraus wird auch Haschisch zum Beispiel durch Siebung gewonnen. Es kann optisch hell ausfallen („Pollen“) oder dunkel-schwarz wie Pakistani aussehen („Chocolate“, „Charas“) und soll beachtliche Qualität und Potenz aufweisen können.
KAMBODSCHA
Das sogennnate „Thai-Gras“ mit legendärem psychedelischem Ruf, aber meist eher mäßig potent und chrakterlos, kam schon seit den 1980er Jahren oft nicht mehr direkt aus Thailand sondern aus dem benachbarten Laos, in dem Rauschhanf als Gewürz, zum Beispel für die „Happy Soup“ auf dem Markt bei Tabakhändlerinnen relativ frei verkäuflich war. So war es auch in Kambodscha, wo seit den 1990er Jahren Gras-Speisen in sogenannten „Happy Pizza“-Restaurants speziell an Touristen verkauft wurden. Selten gewinnen diese gesiebtes Haschisch in dünnen Platten aus ungepresstem harzigen Gras, das dann eine rare potente Spezialität darstellt, die den Charakter des Grases, auch wenn es selbst nicht ganz so stark ausfiel, in konzentrierter Form spiritifiziert.
SÜDAFRIKA, TRANSKEI, LESOTHO UND SWAZILAND
Aus dem in den südafrikanischen Ländern aus Sativa-Pflanzen mit manchmal recht hohem THC-Gehalt und interessanten Wirkungsprofilen (man erinnere sich an „Durban Poison“, „Swazi Gold“ und die südafrikanische Genetik mitbringende äußerst erfolgreiche „Power Plant“) und eingeführten internationalen Sorten gewonnenem Gras („Dagga“) wird mittlerweile manchmal auch Haschisch gewonnen. Die aktuelle Legalisierung des Konsums hat schon zu einem zusätzlichen Anbauboom geführt. Haschisch gelangt unter Bezeichnungen wie „Zulu Hash“ vereinzelt nach Europa.
Diese Liste lässt sich wahrscheinlich noch unendlich fortsetzen, aber kehren wir zurück in europäische Gefilde.
Exkurs: Vergessene Haschisch-Länder
Manche Länder spielten einst in der Haschisch-Produktion eine bedeutende Rolle. Dazu zählt Griechenland. Vom 19. Jahrhundert bis noch in die 1920er Jahre stellte das Hochland auf der Peleponnes-Halbinsel um das Städtchen Tripolis herum trotz Anbauverbots von 1890 ein Zentrum des Hanfanbaus zur Haschischgewinnung durch Siebung dar. Das Produkt wurde im Nahen Osten meist über dort lebende Griechen gehandelt und war besonders in Ägypten neben Haschisch aus dem Libanon und Präparaten vom indischen Subkontinent (besonders aber aus Ost-Turkestan) beliebt. Überhaupt war Ägypten ein Hauptabnehmer für meist in der Wasserpfeife gerauchtes Haschisch. Da Haschisch auch in Ägypten verboten war, musste es abenteuerlich geschmuggelt werden. In Alexandria gab es damals sogar ein Haschisch-Schmuggelmuseum. Es wäre interessant, dessen über 100 Jahre alten Präparate, sofern noch irgendwo vorhanden, heute einmal untersuchen zu lassen.
Der Iran, einst Residenz der legendären „Assassinen“, der angeblichen ismaelitischen „Haschischesser“-Sekte, um die sich seit Kreuzfahrer-Zeiten und Marco Polo Legenden ranken, lieferte einst Haschisch, das in Europa wissenschaftlich analysiert wurde.
Ost-Turkestan (heute China) exportierte noch Anfang des 20. Jahrhunderts große Mengen Haschisch (mehrere hundert Tonnen jährlich), vor Allem nach West-Turkestan (Russland) und Indien.
NIEDERLANDE
In den innovationsfreudigen Niederlanden wurde ab den 1990er Jahren zunächst aus den Ernteabfällen (dem Blütenschnitt) professionell Haschisch hergestellt. Dazu haben die weitgehende Sättigung des Sinsemillamarktes mit einheimischen Hanfblüten und die Entwicklung arbeitssparender Maschinen und Methoden (sprich „Pollinator“ und der „Ice-o-lator-Bag“-Siebungstechnik) massgeblich beigetragen. Zunächst wurden vereinzelt Blüten auf über Plastikschüsseln gespannten Seidentüchern gerieben oder gedroschen, so wie man es aus den traditionellen Haschischländern wie Marokko kannte. Dann kamen mit aus der Siebdruckerei stammenden Stoffen bespannte Alurahmen hinzu. Schließlich konnte zwischen den weniger effektiven automatischen Vibrationssieben und einer Art Waschtrommel mit Siebung nach dem Schleuderprinzip (dem „Pollinator“) gewählt werden. Da die Siebung am besten bei niedrigen Temperaturen (bis etwa minus 5 Grad Celsius) erfolgt, wurde an Kühlsystemen getüftelt. Das erhaltene Pulver wird oft nochmal von Hand nachgesiebt. Gepresst wird das in Cellophanpapier dünn ausgebreitete Pulver mit hydraulischen Pressen. Das Ergebnis: Ein ansehnliches professionell gewonnenes und einheitliches Produkt.
Ein Nachteil der Pollinatorsiebung ist die gängige Verwendung von bei der Beschneidung der Sinsemillablütenstände anfallenden blättrigen Teilen. Das Aroma von derartigem Haschisch ist meist recht grasig, selbst wenn die Potenz abhängig vom verwendeten Ausgangsmaterial schon recht hoch ist. Besser noch sind sorgfältig von ohnehin hervorragenden Sinsemillablütenständen (ruhig auch von Hand) gesiebte Qualitäten. Aus zehn Gramm aussengewachsenen Sinsemillablüten der Sorten Skunk oder Northern Lights soll sich etwa ein Gramm excellentes Haschisch sieben lassen. Hier reichen ein bis zwei Züge um die geballte Energie der Ausgangspflanzen kennenzulernen. Derartiges Haschisch zählte zunächst zum Besten, was der Markt hergab. Die verlangten Preise waren allerdings bereits exorbitant bis ausverschämt.
„Nederstuff“ oder „Nederhash“
Typischerweise gelblichbraun oder grünlichbraun, manchmal grünlichschwarz und in dünne Streifen geschnitten an die Frau gebracht, schliesst diese Bezeichnung alles an in den Niederlanden gewonnenem Haschisch ein.
„Skuff“
zusammengezogen aus „Skunk“ und „Stuff“ (Hasch), stand diese Bezeichnung ursprünglich für hochpotentes Haschisch von holländischen Pflanzen der Sorte „Skunk“. Ein anderer auf die Wirkung anspielender Name für solch ein hochpotentes „Skunk-Hasch“ lautet „Flower Power“. Als „Skuff“ werden von manchen auch (zur Haschischgewinnung evtl. noch geeignete) Schnittreste bezeichnet.
„Aurora borealis“
war ein Phantasiename für Haschisch, gewonnen von „Northern Lights-Aurora borealis“-Blüten, konzentrierte Kraft vom Indica-Typ.
„Super Haze Hash“
ist ein aussergewöhnliches Haschisch, insofern es von einer reinen tropischen Sativa (Sortenname „Haze“) stammt. Der Ertrag ist gering, aber wenn es von ausgereiften Blüten gewonnen wurde und noch frisch geraucht wird, ist es von enormer stimulierender Sativa-Potenz, „guten Flug“.
„Orange Hash“
von der Kreuzung „California Orange“. „Zwei Stunden Power auf einem interessanten Level zwischen Indica und Sativa.“ berhaupt wirkt sorgfältig gesiebtes Haschisch von potenten frischen Grassorten ausgesprochen intensiv und anhaltend. Generell kann der „Geist“ jeder Grassorte auch in Haschisch geballt werden. Erste und zweite Siebung sind möglich, ebenso wie klare, fast psychedelische, exotische Spezialitäten a la „Central Mexican Sativa Hash“.
„Bubble-Hash“
Eine weitere Revolution war die „Ice-o-lator“-Siebungstechnik (mit Hilfe von Kunststoff-Siebbeuteln oder kompletten Geräten, Wasser und Eis). Über sie kann man aus Schnittresten, oder besser noch den Blüten selbst, die nicht einmal getrocknet worden sein müssen, hochkonzentrierte allerdings auf Grund des Einsatzes von Wasser tendenziell weniger aromatische und schimmelgefährdete Haschisch-Konzentrate ausgewählter (Sinsemilla-) Pflanzen gewinnen, die so harzig sind, dass sie beim Erhitzen schmelzen, blubbern und verdampfen. Das nennt man „Full Melt“. Hier nehmen die Phantasie-Namen für die Produkte Bezug auf die Ausgangspflanzen, den Hersteller, die vermeintliche oder echte Qualität und/oder die Wirkungen. Während in ersten niederländischen Siebungs-Haschsorten bereits beachtliche über 20 % THC gemessen wurden, trumpfte vor Allem das Bubble-Hash des 21. Jahrhunderts mit bis zu 40 % THC-Gehalt und noch deutlich darüber hinaus auf. Die „Ice-O-Later-Bags“ lassen sich leicht transportieren. So produzieren manche Kleinschmuggler entsprechendes Haschisch in traditionellen Cannabis-Anbauländern vor Ort. Das sind dann außergewöhnliche Spezialitäten für Freunde lokaler Cannabinoid-Profile. Mittlerweile benutzen auch professionelle Produzenten vor Ort (z.B. in Marokko und Indien) die Ice-o-lator-Technik und bringen so überraschend potente Produkte zustande, die den Markt bereichern.
„Rosin-Öl“
ist ein Übergangsprodukt zwischen Haschisch und Öl. Es wird durch Pressen von besonders harzreichen Cannabisblüten, aber auch von Haschisch unter Einsatz von Hitze und Druck zum Beispiel mit Hilfe von Plätt- und Bügeleisen hergestellt. Das ablaufende Harz stellt das nach einem Verbreiter dieser Technik (im Kleinformat) benannte Öl dar. Von so einem unter Druck und Hitze abgepressten Harz berichteten Jamaika-Reisende schon in den 1980er-Jahren. Zur Gewinnung des „Rosin“-Pressharzes gibt es mittlerweile extra Gerätschaften.
„Öl“, „710“, „Budder“, „Wax“, „Glas“, „Shatter“
Abgelöst wurde der letzte Haschisch-Hype um das „Bubble-Hash“ in den vergangenen Jahren durch die Verbreitung von mittels diversen Lösungsmitteln hergestellten Extrakten, schlicht „Öl“ (englisch „Oil“ oder verdreht „710“) genannt. Extrahiert wurden sie bereits im 19. Jahrhundert, also sozusagen traditionell, mittels Alkohol. Später kamen Isopropylalkohol, Petroläther, Wundbenzin, Hexan etc. pp. als gesundheitlich bedenkliche Lösungsmittel hinzu. Eine explosionsgefährdete „BHO“-Extraktion mittels flüssigem möglichst reinem Butangas über den sogenannten „Honeybee-Extractor“, eine Röhre aus Kunststoff, Glas oder Metall erfreut sich seit einigen Jahren bei Kleinproduzenten zunehmender Beliebtheit. Verflüssigter reiner Dimethyläther ist das Mittel der Wahl bei dessen aktuellen Nachfolgegeräten. „Budder“, „Wax“, „Glas“, „Shatter“ sind Namen für teilweise von wasserlöslichen Stoffen, Farbstoffen, Terpenen, Wachsen, Fetten und nicht erwünschten Cannabinoiden vor- oder nachgereinigte Produkte, die auf verschiedenen Wegen, wie sie im Internet gezeigt werden, hergestellt werden. Neuerdings werden in den quasi-legalisierten US-Bundesstaaten mittels Flüssig-CO 2-Extraktion im geschlossenen System analog zur Hopfen- oder Heilpflanzen- und Duftpflanzen-Extraktion High-Tech-Extrakte hergestellt und teilweise sogar wieder gemischt oder mit Terpen-Destillaten (die zu Aromen und möglicherweise auch Wirkungsvarianten beitragen) zu synthetischen Wunschprodukten zusammengeführt. Dabei werden nicht nur getrocknete Schnittabfälle, Blütenstände oder gar Haschischpulver, sondern auch frische tiefgefrorene Blütenstände als Ausgangsmaterial eingesetzt. Genutzt werden alle Extrakte, wenn sie inhaliert werden sollen, zum Verdampfen, bevorzugt dem „Vaporisieren“ mit entsprechenden Geräten oder dem „Dabben“ mit entsprechendem Pfeifenzubehör. Öl-Extrakte wurden auch zum Aufwerten von Haschisch-Produkten oder zur Kreation künstlicher Haschisch-Imitationen verwendet. Die Chemisierung der Cannabis-Produkte und deren immer höherer THC-Gehalt (über 60 % sollen keine Seltenheit sein, bei 100 % glasklarem bei kühlen Temperaturen festem „Dronabinol“/THC wäre bei dieser Entwicklung dann theoretisch und praktisch Schluss) sind eine medizinisch-pharmazeutisch sehr interessante, im Bereich des Genusskonsums aber durchaus umstrittene Entwicklung, die ähnlich kontrovers diskutiert wird, wie beim Alkohol der Konsum von Wein und/oder Schnaps. Die Einen loben die Reinheit und Potenz der Produkte, die Anderen bedauern einen Genuss- und Kulturverlust und warnen vor Überdosierungsrisiken bei gelegentlichem Konsum und einem Hochdosierungsrisiko beim Dauergebrauch solcher THC-Konzentrate. Die Entwicklungen werden aber auf Grund ihrer zahlreichen begeisterten Protagonisten nicht aufzuhalten sein, noch interessante Erkenntnisse zum Zusammenspiel der diversen Cannabis-Komponenten und weitere Produktkreationen bringen.
SCHWEIZ
Während den liberalen 1990er Jahren wurde in der Schweiz insbesondere sehr viel Freiland-Hanf für Duft-Kisslis angebaut. Der Gras-Markt war zeitweilig so gesättigt, dass auch durch Siebung gewonnenes Haschisch produziert und exportiert wurde. Die in Deutschland und den Niederlanden in dieser Zeit angebotenen Qualitäten reichten von muffig-ammoniakalischen Platten von der Optik einer Euro-Platte, die Keiner haben wollte, bis zu kleinen hellen, recht trockenen 20-Gramm-Täfelchen mit eigenen Logos und angenehm stimulierendem High an der oberen Preisgrenze dessen, was damals für gute Qualitäten bezahlt wurde (20 DM/g). Vor Ort bei den Produzenten gab es diverse Qualitäten. Nachdem es in der Schweiz rechtlich eng wurde, zogen sich Avantgarde-Grower entweder in den Untergrund zurück oder mit der Karawane weiter in liberalere Länder wie Spanien.
ALBANIEN
Lazarat(in) heißt ein kleiner Ort im Süden Albaniens, der sich vollkommen dem Rauschhanfanbau verschrieben hatte, wie sich 2012 jeder auf Youtube ansehen konnte. Dort soll aus niederländischem Hybrid-Kreuzungs-Saatgut in Zusammenarbeit mit italienischen Mafiosi 2013 eine Jahresproduktion von 900 t Hanfblüten erreicht worden sein. Exportiert wurden sie hauptsächlich nach Italien und Griechenland. Inwieweit auch Haschisch hergestellt wurde, ist unbekannt. Am 16. Juni 2014 erfolgte eine 3-tägige Razzia, bei der sich die schwer bewaffneten Dorfbewohner zur Wehr setzten und 102 t Marihuana, sowie 530.000 Cannabispflanzen beschlagnahmt wurden.
Seitdem (2015/2016) hat sich der Anbau in unbewohnte Bergregionen (wie die Dukagjin-Berge in Nord-Albanien) verlagert, in denen immer noch teilweise beachtliche Plantagen angelegt werden. Im Süden werden Terpelene und Lushnje (Kadiaj) als neue Anbauzentren genannt. ISIS-Propagandisten sollen in der Region aktiv sein.
Exkurs: Fair-Haschisch
Nur unter den Bedingungen einer Legalisierung lässt sich verhindern, dass Organisiertes Verbrechen (überall), Terroristen (z.B. Marokko, Türkei, Libanon), Warlords (z.B. Afghanistan, Pakistan), Rebellen (z.B.Nepal), korrupte Regierungsvertreter, Militärs und Polizisten (überall) von Hanfanbau, der Gewinnung von und dem Handel mit Hanfprodukten profitieren. Nur so lässt sich einrichten, dass der Hanf ökologisch korrekt, ohne Umweltzerstörung und Einsatz gesundheitsschädlicher Hilfsmittel angebaut und verarbeitet wird. Nur so können letztlich glaubwürdige Prävention und Konsumentenschutz geleistet, aber auch faire Arbeitsbedingungen für alle in der Industrie Beschäftigten geschaffen werden. Unter den Bedingungen der Illegalität bietet die vom Kleinstbauern selbst kontrollierte Eigenproduktion bei entsprechenden Kenntnissen diesem die einzige halbwegs zuverlässige Gewähr dafür, was hier produziert wird.
DEUTSCHLAND
1995 kam erstmalig von in Deutschland gewachsenen Pflanzen mit dem „Pollinator“ kommerziell getrommeltes Haschisch zu hohen Preisen auf den Markt. Die deutschen Rauschhanfbauern folgen den Trends ihrer internationalen Kollegen. Der Kleinbäuerin erschliessen sich mit „Fingerhasch“ oder „Scherenhasch“ (bei der Ernte und Verarbietung anfallend) und dem „Pollenshaker“ vom Typ „Haschmacher“ auf simple Weise die Freuden selbstgewonnenene oder geschüttelten Harzdrüsenpulvers, nach wie vor der natürlich gewonnenen „Creme de la Creme“ des Hanfes.
az
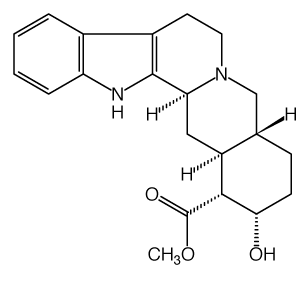




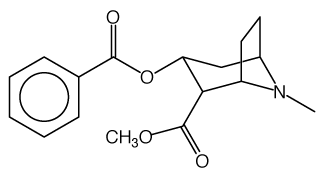




 Chillum or German Urbock Beer?
Chillum or German Urbock Beer?